Abfotografieren von Filmen (Dias und Negative) mit der Digitalkamera
Anstatt sich einen Filmscanner anzuschaffen, kann man seine Filme (Negative und Dias) auch mit einer Digitalkamera abfotografieren. Macht man dies richtig, erhält man durchaus eine gleich hohe Qualität. Dies Sache hat jedoch auch Tücken, welche besprochen werden. Es werden diverse Möglichkeiten vorgestellt (auch via Smartphone), ein Vergleich mit einem Scanner wurde gemacht und es wird auch auf die anschließende Bildbearbeitung eingegangen.
 Scannen lassen: Gutscheincode »ANALOG« – Sie erhalten 12 % Rabatt auf einen Auftrag bei MEDIAFIX für Budget-Scans mit 2.900 dpi bis hin zu Profi-Scans mit dem Hasselblad Flextight X5 für Dias und Negative unterschiedlicher Filmformate mit diesem Code.
Scannen lassen: Gutscheincode »ANALOG« – Sie erhalten 12 % Rabatt auf einen Auftrag bei MEDIAFIX für Budget-Scans mit 2.900 dpi bis hin zu Profi-Scans mit dem Hasselblad Flextight X5 für Dias und Negative unterschiedlicher Filmformate mit diesem Code.
Um die Filme meiner analogen Kameras zu digitalisieren, nutze ich gerne solch eine Leuchtplatte mit Buchbildbühne. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, welche in diesem Beitrag besprochen werden. Dieser ist sehr lang, doch er geht auf sehr viele Details ausführlich ein.
- Ich habe wenigstens eine gute Digitalkamera
- Ich habe ein Smartphone mit guter Kamera
- Vorrichtungen zum Digitalisieren
- Welche Lichtquelle ist zum Abfotografieren geeignet?
- Die Filmhalter
- Das richtige Objektiv: Nimm ein Makro-Objektiv
- Weitere Tipps für eine hohe Bildqualität
- Gute Digitalkamera
- Manueller Modus 16 Bit RAW
- Der ISO-Wert
- Die Belichtungszeit
- Ausrichtung der Kamera mit einem Spiegel prüfen
- Den Raum abdunkeln
- Einen Fernauslöser verwenden
- Einen Blaufilter für Farbnegativfilme nutzen
- LiveView oder Sucher?
- Autofokus oder manueller Fokus?
- Filter nutzen?
- Die Spiegelvorauslösung verwenden
- Lampe erwärmen
- Den Negativrand mit fotografieren
- Sauber arbeiten: Staub und Fussel vermeiden
- Stitchen: Mehr Auflösung als die Kamera erlaubt
- Tethering: Das Bild gleich an den Laptop senden
- Die Bildbearbeitung: Umwandlung in ein Positiv
- Grundlagen bei der Umwandlung eines Farbnegativ in ein Positiv
- Mit SmartConvert
- Mit Adobe Camera Raw
- Mit Negmaster (Photoshop-Plugin)
- Mit ColorPerfect (Photoshop-Plugin)
- Mit Grain2Pixel (kostenloses Photoshop-Plugin)
- Mit RAWTherapee (kostenlos)
- Mit Darktable und dem Negadoctor-Modul (kostenlos)
- Holzhammer-Methode: Auto-Weißabgleich / Auto-Farbkorrektur
- Mit Lightroom + Negative Lab Pro Plugin
- Mit VueScan
- Ein Gedanke zu den Bilddateien
- Bildvergleich mit einem Epson V750 Scanner
- Scannen oder Abfotografieren?
Die Frage, wie man seine fotografierten Filme oder gar selbst entwickelten Negative in eine digitale Datei umwandeln kann, trieb schon so manchen Freund der analogen Fotografie um. Der naheliegendste Gedanke geht hier sicherlich in Richtung einen Filmscanner zu erwerben. Gute Geräte sind jedoch ziemlich teuer. Sie besitzen eine moderne Kamera? Vielleicht eine Spiegelreflexkamera (DSLR) oder eine spiegellose mit der Möglichkeit, Wechselobjektive zu nutzen? Dann können Sie auch mit der Digitalkamera „scannen“: Man kann analoge Filme auch abfotografieren und die damit erzielbare Qualität kann ziemlich hoch sein!
Der gesamte Artikel ist sehr lang und sehr ausführlich. Er lässt sich in wenigen Sätzen zusammen fassen, wenn man eine hohe Druckqualität erreichen möchte:
- Für hochwertige Ergebnisse muss der Film vor einer „farbechten“ homogenen Leuchtfläche planparallel zu einem guten Makro-Objektiv positioniert sein.
Für S/W-Filme reicht eine normale Leuchtplatte.
- Die Vorrichtung sollte stabil, reproduzierbar aufbaubar und justierbar sein: Ein Provisorium macht kein Vergnügen.
- Zudem müssen Sie im Anschluss eine hierzu passende Bildbearbeitung bzw. Software beherrschen – insbesondere wenn es sich um Color Negative handelt, weniger wenn es sich um Dias oder S/W-Film handelt.
Möchten Sie analoge Vorlagen digitalisieren / transformieren, befinden Sie sich schon mitten in der technischen Repro-Fotografie. Hierbei gibt es so Manches zu beachten, was für die „normale“ Fotografie nicht relevant ist.
Nicht umsonst gibt es daher viele Digitalisierungs-Anbieter. Wer sich die Kosten hierfür sparen möchte, sollte diese Anleitung studieren oder zumindest einige interessante Punkte des obigen Inhaltsverzeichnisses ansteuern. Eine „bequeme Abkürzung“ gibt es hierbei nicht, wenn man Wert auf Qualität legt.

Bei guter Technik erhält man durch das Abfotografieren von Filmen eine sehr hohe Qualität bzw. eine so hohe Auflösung, dass winzige Details sichtbar werden (hier am Beispiel eines 6×6-Farb-Negativs).
In dieser Anleitung werden mehrere Möglichkeiten (Aufbauten) vorgestellt. Zudem wird insbesondere für das Abfotografieren von Negativen / Dias auf der Leuchtplatte (mein Favorit) alles aufgezählt, was man benötigt. Es wird auch erklärt, welche Einstellungen an der Digitalkamera nötig sind und es wurden einmal verschiedene Objektive verglichen. Außerdem erkläre ich, wie ich meine digitalen (Color-) Negative in Positive umwandele (Bildbearbeitung). Auch wird einmal die Qualität mittels Scannen mit der durch das Abfotografieren verglichen. Zudem gibt es so manch Wink aus der Praxis. Dieser Artikel ist mittlerweile zu einem richtigen kleinen Lehrbuch angewachsen mit vielen Hinweisen und Tipps, die nacheinander studiert werden können.
Ich habe wenigstens eine gute Digitalkamera
Bevor es ins Detail geht, stellt sich der eine oder die andere die Frage, wie man gleich loslegen kann, wenn man bereits eine gescheite Digitalkamera besitzt, am Rest jedoch eher sparen möchte.
Zunächst muss die Kamera auf einem Stativ nach unten schauen können. Hierfür braucht man ein Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule und Kugelkopf ( ; Preis vom 26. Juli 2024). Die Kamera muss schließlich fest, sicher und genau positionierbar sein.
- Man benötigt ein gutes Makro-Objektiv. Zumindest als Nikon-Nutzer kann man auch die alten Nikkor-Micro-Objektive aus den 1980er Jahren nutzen (via Ebay gebraucht ca. 100 Euro – hier darauf achten, dass es die kompatible Ai-Version ist). Für z. B. Canon gibt es ältere, günstige FD-Objektive und Adapter für das EOS-System. Bei anderen Marken wird es ähnlich sein. Natürlich kann man auch teure neue Makroobjektive nutzen. Zunächst kann man es auch mit einem „normalen“ Objektiv passend zur Kamera probieren (wird aber unscharfe Ränder erhalten, wie bei diesem Vergleichsfoto gezeigt). Dann braucht man aber noch:
- einen simplen Zwischenring, damit man auch Kleinbild-Negative formatfüllend digitalisieren kann. Hat man kein Makro-Objektiv ist ein solcher Zwischenring (oder Balgengerät) jedoch Pflicht. Doch auch für viele Makro-Objektive benötigt man noch einen solchen (kurzen), wenn Kleinbild-Motive formatfüllend (= Maßstab 1:1) abfotografiert werden sollen.
- Nun benötigt man noch eine Leuchtplatte:
- Möchte man lediglich S/W-Filme abfotografieren, reicht eine einfache, günstige Leuchtplatte. Eine solche ist bereits ab ca. 15 Euro zu haben und sie ist eigentlich für das Abpausen oder ähnlichem gedacht. Doch Vorsicht: Man sollte hier in Erfahrung bringen, inwiefern die Oberfläche ohne Rasterung ist.
- Sollen Farbnegativfilme oder Farbdiafilme mit der Kamera digitalisiert werden, wäre eine bessere Leuchtplatte mit hohem „CRI-Wert“ die klügere Wahl, wenn man Wert auf Qualität (Farbtreue) legt und sicher gehen möchte, dass alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist und es keine Rasterung gibt.
Zuletzt muss das Negativ / das Dia noch gescheit positioniert werden können (ein simpler jedoch wichtiger Punkt). Im einfachen Fall besorgt man sich ein Antireflex-Glas aus einem Bilderrahmen und legt dieses unten auf die Leuchtplatte. Dieses hat eine mikroskopisch raue Oberfläche. Darauf liegt der Film mit seiner glatten Seite und ganz oben wird ein hochwertiges Klarglas (ebenfalls aus gutem Bilderrahmenglas) positioniert. Auf diese Weise erhält man eine perfekte Planlage (wichtig für eine hohe Auflösung und Schärfe) und beugt den berüchtigten Newtonschen Ringen (dazu später mehr) vor. Ich selbst schwöre hier auf eine Buchbildbühne. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Filme (möglichst) planparallel zum Objektiv zu montieren (dazu auch später mehr).


Hier eine Detailansicht: Ein Ausschnitt aus einem mittels Makroobjektiv abfotografierten (und konvertierten) Kleinbildnegativs (Adox CHS 25). Ein Scanner der Spitzenklasse wird vermutlich auch nicht viel mehr aus solch einer Vorlage heraus holen können.


Detail in der Ferne: Mit einem Makro-Objektiv und guter Filmhalterung (die den Film planparallel hält) ist eine sehr hohe Abbildungsqualität durchaus möglich – hier vom Kodak T-Max 100, im Kleinbild wohl gemerkt.
Ich habe ein Smartphone mit guter Kamera
Innerhalb dieses Artikels geht es (mir) immer darum, eine möglichst hohe Qualität (= hohe Auflösung) mit der Reproduktion der analogen Negative oder Dias zu erlangen. Wer seine Dias lediglich auf z. B. einem großen Fernsehgerät vom Sofa aus betrachten möchte, der benötigt nicht unbedingt das Optimum an Abbildungsleistung (Makroobjektiv, Stativ, spezielle Software, …). Mittlerweile gibt es Smartphones mit tatsächlich guter Kamera. Dies täuscht zwar häufig, wenn man sich die damit gemachten Fotografien lediglich auf dem winzigen Handybildschirm anschaut. Mit etwas Betrachtungsabstand vom Monitor / TV-Gerät befriedigt die Qualität häufig auch höhere Ansprüche. Und so kann eine hierfür angefertigte Vorrichtung fürs Abfotografieren via Smartphone ausschauen:

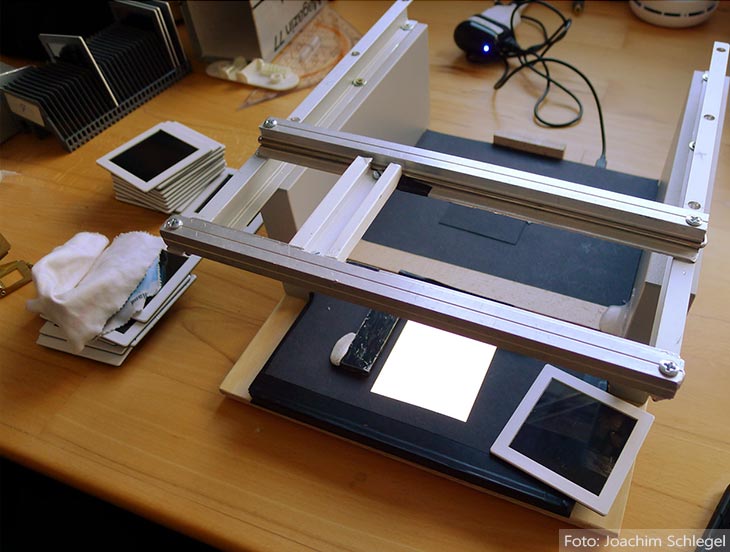
Ein freundlicher Leser meiner Seite hat mir extra diese Fotos zugesandt: Er positioniert mit dieser Vorrichtung aus Holz und Metallleisten das Smartphone in einer ganz bestimmten Höhe planparallel zu einer Leuchtplatte mit neutraler Farbtemperatur (Kaiser Slimlite), die – bis auf einen Ausschnitt – mit schwarzem Karton abgeschattet ist und ganz unten positioniert ist. Die gerahmten Dias werden kurz gesäubert und dann nacheinander an einer Führung exakt angelegt bzw. auf der Leuchtplatte positioniert. Die Smartphone-Kamera belichtet dann von oben korrekt und fertig ist die Digitalisierung. Diese Fotos können dann gleich im Anschluss direkt vom Smartphone via z. B. „AirPlay“ oder „UPnP / DLNA“ auf ein hierfür kompatibles Endgerät (Smart TV) zum sofortigen Betrachten übertragen werden.

Hier ein Beispielfoto: Wer sich einmal die Fotografien, die ein Smartphone macht, bei 100% auf einem großen Monitor angeschaut hat, wird nicht selten einen seltsamen „Ölmalerei-Filter“ festgestellt haben: Die Hersteller scheinen hier mit ihren Megapixel-Angaben bzw. Bildergebnissen noch zu tricksen (die Fotos werden intern offenbar „aufgeblasen“) und die Ergebnisse unterscheiden sich natürlich zu denen, die man mit einer „echten“ Digitalkamera erlangen kann. Aber in kleinerer Ansicht (z. B. für den Computermonitor / Internet) funktionieren diese Digitalisierungen oder auch mit etwas Betrachtungsabstand (Sofa ↔ großer Smart-TV / Beamer).
Die sicherlich günstigste und einfachste Art, Kleinbild-Dias und -Negative zu digitalisieren: mit dem eigenen Smartphone. Hierzu gibt es einen Aufsatz, der oben das Handy hält. Unten befindet sich ein Leuchtpult zum Durchleuchten. Natürlich erhält man hierdurch nicht die Qualität eines richtigen Filmscanners. Für kleinere Drucke oder das Teilen via sozialem Netzwerk reicht die Bildqualität sicherlich aus.
Der Vorteil eines Smartphones gegenüber einer Digitalkamera: Man benötigt keine Zwischenringe bzw. kein Makroobjektiv (jedes Smartphone schafft Makrofotografien bzw. man kann genügend nah ans Motiv heran gehen). Der Nachteil: Konservative Qualitätsansprüche befriedigt man mit dieser sehr praktischen, günstigen (weil „Kamera“ und „Objektiv“ meist vorhanden) und einfachen Technik jedoch selten. Obacht: Bei diesem Beispiel wurden gerahmte Dias abfotografiert. Dies sind die einfachsten Vorlagen. Insbesondere für Farbnegative benötigt man noch eine passende Software bzw. eine passende „App“ auf dem Smartphone, die die orangenen Negative invertiert und in logisch erscheinende Farbfotografien umwandelt. Bereits auf dem Computer ist dies nicht trivial (siehe meine Liste mit Software ganz unten). Ich selbst habe keine Erfahrung mit Smartphone-Programmen, die so etwas befriedigend schaffen. Für lose Filme (ohne Rahmung) benötigt man zudem noch eine Vorrichtung zum platt Drücken.
Smartphone zur Auswahl nutzen
Für eine Sache nutze ich aber mein Smartphone: Man kann damit prima eine Auswahl treffen, wenn man sehr, sehr viele Dias / Negative hat, von denen man aber nicht alle digitalisieren möchte bzw. dies zeitlich nicht kann:

Man muss hierfür keine Fotos machen: Man hält das Handy einfach über die Vorlagen, welche auf der Leuchtplatte liegen und sieht invertiert sofort „live“ einigermaßen richtig konvertierte Positive. Es gibt hierfür diverse kostenlose Apps. In diesem Artikel hatte ich eines dieser Programme genauer vorgestellt. Sie sind eigentlich tatsächlich für das Digitalisieren gedacht (was bedingt geht). Aber sie eignen sich gut als Vorschau zur Auswahl.
Es gibt natürlich noch andere, bessere Möglichkeiten zum Abfotografieren von analogen, transparenten Vorlagen, auf die jetzt sehr ausführlich eingegangen wird. Im Anschluss gibt es viele weitere Tipps für perfekte Ergebnisse.
Vorrichtungen zum Digitalisieren
Sicherlich kann man das Negativ / Dia auch einfach mit etwas Klebeband an der Fensterscheibe fixieren, von Außen eine weiße Folie vor dem Glas befestigen und das ganze aus der Hand mit der Digitalkamera fotografieren. Mit Glück bekommt man damit ein Bild für kleine Ausdrucke (oder fürs Internet) hin. Mit solchen wackeligen Improvisationen möchte ich mich allerdings nicht beschäftigen. Doch viele Vorrichtungen zum Abfotografieren führen nach Rom: Seit Digitalkameras eine genügend hohe Auflösung bieten, beschäftigte sich schon so manch Fotofreund damit, wie analoge Aufnahmen mittels DSLR oder spiegelloser Kamera ordentlich digitalisiert werden können. Es gibt hier mehrere Lösungsansätze, wobei die Aufzählung mit den eher kuriosen beginnt und mit praktischen Schreibtischlösungen endet:
Umbau eines Diaprojektors

Bei so einem Diaprojektor kann man leicht das Objektiv entfernen. Durch die Magazine ist ein sehr schneller Bildwechsel möglich.
Diese Vorrichtung ergibt eigentlich nur für gerahmte Dias Sinn und wenn man tausende davon digitalisieren möchte. Denn das Abfotografieren hiermit geht rasend schnell. Hierzu wird einfach das Objektiv des Projektors entfernt (heraus gezogen) und eine Diffusorscheibe vor die Lampe im Diaprojektor gesetzt. Letzteres ist nicht so einfach, da das Gerät geöffnet werden muss. Man kann die Halogenlampe auch durch eine schwächere ersetzen, dann wird der Projektor auch nicht so warm. Er fungiert nun als „Leuchttisch“ und die Dias lassen sich abfotografieren, indem die Kamera mit dem Makro-Objektiv (min. mittleres Tele = lange Brennweite) vorne hinein schaut. Sie ist dabei auf einem Stativ oder einer Holzplatte waagerecht ausgerichtet. Wer sich für solch eine Lösung interessiert, findet hier weitere Tipps. Zudem wird das nötige Zubehör als Bausatz angeboten: „Fotonovum Diadigifix„. Präzision ist hier eher nebensächlich. Die Qualität ist sicher in Ordnung. Es geht dabei hauptsächlich um Geschwindigkeit bzw. darum, ganze Archive digitalisieren zu können.
Es gibt auch teure Diascanner mit automatischem Einzug. Entweder man kauft sich einen solchen und veräußert diesen später wieder, wenn es um das einmalige Digitalisieren eines großen Archivs geht. Oder aber man mietet sich einen Diascanner.
Mongoose: Digitalkamera zum Scanner umfunktionieren
Ein neues Kickstarter-Projekt möchte folgendes erreichen:
Eine Kontrolleinheit steuert a) eine Digitalkamera und gleichzeitig b) eine Film-Spulvorrichtung mit synchronisiertem Motor, welche vor einer Leuchtfläche positioniert sein muss. Das ganze sieht dann so aus (Youtube-Video) und nennt sich „Mongoose“ (englisch für Mangusten):
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
So etwas wäre natürlich nur für das schnelle Digitalisieren von noch ungeschnittenen Kleinbildfilmen relevant – aber allemal interessant (eine präzise Planlage wird allerdings eher mäßig realisiert werden können). Die Kamera wird damit aber tatsächlich zum (automatischen) Scanner. Eine Bildbearbeitung muss später freilich dennoch vorgenommen werden. Sicherlich sind diese kleinen, niedlichen Mungos ziemlich flink und daher rührt der Name. Das Kickstarter-Projekt (eine Seite, wo man für kleinere Produktionen Geld sammeln kann) befindet sich hier online.
Eine bereits seit vielen Jahren gebräuchliche behäbigere aber dafür präzisere Lösung wäre auch:
Mit dem Labor-Vergrößerer digitalisieren
Wenn Sie Ihre Negative im eigenen kleinen Fotolabor vergrößern (so wie ich), dann besitzen Sie einen Vergrößerer. Dieses Gerät weist bereits zwei Punkte auf, die bei einer Vorrichtung für das Abfotografieren wichtig sind: Eine gleichmäßige Ausleuchtung des Negativs (Mischbox bzw. Kondensor) sowie eine gescheite Halterung hierfür zur Positionierung und zum plan halten (Bildbühne). Wenn Ihr Gerät mittels Halogenlampe betrieben wird („Farbkopf“), besitzen Sie zudem ein perfektes Leuchtmittel: Denn Halogenlampen haben einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI-Wert), was für das Duplizieren von Farbnegativen bzw. Farbdias nicht ganz unwichtig ist.
Der Trick ist nun, dass man die Kamera ohne Objektiv direkt unter das Vergrößerungsobjektiv schraubt (mittels diverser Adapterringen). Dazwischen befindet sich ein Balgengerät. Der Vorteil: Man nutzt hier einfach das Vergrößerungsobjektiv. Ein eigenes Makroobjektiv ist nicht nötig. Zudem gelingt das Ausrichten / Verstellen sehr präzise. Allerdings ist hierfür eine Digitalkamera mit schwenkbarem Monitor erforderlich oder ein Winkelsucher. Da ich meine Dunkelkammer nur temporär im kleinen Raum aufbaue, ist diese Vorrichtung nichts für mich und ich habe hier auch keine Tests vorgenommen. Ich möchte eine anwenderfreundliche Schreibtischlösung haben. Wie die eben besprochene Variante ausschaut, kann man sich auf dieser Website anschauen (hier wurde sogar auf den Balg verzichtet).
Andere Möglichkeit: Wenn man einen Vergrößerer mit Mischbox besitzt, kann man dessen Kopf von der Säule abmontieren, umdrehen bzw. als Leuchtfläche nutzen und dort die Bildbühne auflegen. Der Vorteil: Die verbaute Halogenlampe ist für Farb-Reproduktionen außerordentlich gut geeignet und natürlich sehr hell. Der Vergrößerungskopf steht dabei umgedreht auf dem Tisch, an der Säule befindet sich die Kamera mit einem passenden (Makro-) Objektiv.
Oder: Man belässt den Vergrößerungskopf einfach an der Säule des Vergrößerers, entfernt aber das Objektiv (am Vergrößerer), dreht den Kopf mit dem eingelegten Film um 90° und fotografiert einfach von der Seite hinein. Die Kamera mit dem Makroobjektiv (möglichst lange Brennweite) steht hierbei auf einem Stativ gegenüber. Das Prinzip ist dann das selbe wie beim in den Diaprojektor hinein fotografieren. Hier hat man aber den Vorteil, dass man einfach die gute Buchbildbühne in ihrer ursprünglichen Position belassen kann und dass alles fest montiert bleibt. Der Balgen des Vergrößerers dient nun außerdem als ideales Kompendium zum Abschatten von Fremdlicht.
Nutzt man einen Farbkopf, kann man beim Abfotografieren von Farbnegativfilmen (orangene Maske) vermutlich den Cyan-Regler als Alternative zum Blaufilter nutzen, um bereits optisch etwas auszufiltern bzw. um zu verhindern, dass die spätere digitale Datei in der Bildbearbeitung sozusagen zu sehr „strapaziert“ wird.
Blitz-Box selbst gebaut
Wenn Sie einen entfesselbaren Blitz besitzen, können Sie diesen für das Abfotografieren von Film nutzen. Ich hatte mir hierzu eine entsprechende Vorrichtung gebaut, ein Selbstbau: Unten steht ein Rahmen aus Metallstreben. Hierzu nutzte ich einfach den Ikea Bosnäs Hocker bzw. dessen Innengestell. Denn dieses ist ein sehr stabiles Gestell, welches sich sehr gut für diese Zwecke eignet. Darunter wurde das Blitzgerät gelegt, welches via Funkauslöser von der Digitalkamera entfesselt ist (Leuchtfläche zeigt nach oben). Ungefähr in der Mitte des Metallgestells meines Selbstbaus zum Abfotografieren wurde ein weißer Diffusor mit Draht (Blumenbindedraht) positioniert. Dieser muss sein, da die Leuchtfläche des Blitzes ja für das Abfotografieren vergrößert werden muss.
Oben auf das Gestell legte ich einen 30 x 40 cm Bilderrahmen ohne Rückwand – also einfach eine Glasfläche. Auf dieser (sauberen und hochwertigen) Glasfläche wird nun einfach der Film positioniert. Damit sich dieser nicht wellt, kann noch ein weiteres Glas aufgelegt werden. Idealerweise nutzt man hierbei AN-Glas (Antinewtonglas), denn eine glatte Glasfläche auf der glatten Seite des Negativs erzeugt häufig Ringe (Newtonringe). Besser wäre: Man nimmt entspiegeltes Rahmenglas (raue Seite nach oben) und legt darauf das Negativ – mit der glatten Seite nach unten. Die (raue) Schichtseite des Filmes zeigt nun korrekt nach oben zur Kamera und zum plan halten reicht ein kleines, normales Klarglas bester Qualität. Zum Thema reflexfreies (angerautes) Rahmenglas gibt es einen gesonderten Artikel.
Oder aber man nutzt zur Positionierung einen Filmhalter. Auf diese Halter gehe ich weiter unten genauer ein, denn diese sind wichtig. Zudem benötigt man hierzu natürlich ein ordentliches Stativ, bei welchem sich die Mittelsäule drehen lässt! Da ich jedoch auch einen Vergrößerer besitze, kann ich einfach auch dessen Säule bzw. dessen Unterlage nutzen. Solch eine verstellbare Reprosäule ist ideal für das Abfotografieren mit der Digitalkamera, da man mittels der Kurbel die Höhe sehr elegant und präzise einstellen kann und keine Stativbeine im Weg sind. Neu haben Reproständer ihren Preis. Als Alternative empfiehlt sich die stabile Säule eines (gebrauchten) Vergrößerers.
Grundsätzlich benötigt man natürlich auch bei dieser Vorrichtung ein Makro-Objektiv oder wenigstens Zwischenringe für das bereits vorhandene Standard-Objektiv (Festbrennweite).
Damit hat man bereits einen ordentlichen Aufbau, bei dem nichts wackelt und man kann alle Filmformate abfotografieren (auch riesige Planfilme). Zudem spielt hierbei das Raumlicht keine Rolle: Durch eine sehr kurze Belichtungszeit beim Blitzen kann dieses sozusagen „ausgesperrt“ werden. Reflexionen auf dem Film sind nicht zu erwarten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Elektronenblitz per se ein äußerst gutes Licht (weiß, hoher CRI-Wert) für das Durchleuchten von Color-Negativen besitzt. Dies ist für später nicht ganz unwichtig, wenn es um die Umwandlung in farbrichtige Positive gehen soll. Eine gute, moderne Leuchtplatte hat aber ähnliche Werte (dazu gleich mehr).
Der große Nachteil bei diesem Selbstbau: Man hat kein Einstelllicht zum Fokussieren! Wenn es im Raum zu dunkel ist, kann man nicht präzise aufs Korn scharf stellen. Ich behalf mir hierbei, indem ich unten eine starke Taschenlampe hin stellte und diese bei der Aufnahme wieder ausschaltete. Spaß macht dies aber nicht und der gesamte Aufbau ist schon recht aufwendig.
Die Vorteile: Das Blitzlicht ist absolut neutral (der Diffusor sollte es jedoch auch sein!). Ich erwähnte es eben schon: Blitzlicht hat einen sehr hohen CRI-Wert (man kann alle Farben realistisch abbilden). Zudem braucht man eine Spiegelvorauslösung an der Kamera beim Blitzen nicht (Ich würde sie vorsichtshalber dennoch nutzen). Eine simple Leuchtplatte ersetzt jedoch den gesamten Aufbau mit Blitz, Rahmen, Diffusor, Glasscheibe und daher bin ich nicht dabei geblieben. Brauchbare Leuchtplatten sind heute günstig genug, dass ich mir das selber Bauen erspare, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Freund von Blitzlicht bzw. der Taschensonne beim Fotografieren bin.
Früher gab es übrigens den sogenannten „Multiblitz Dia Duplicator“. Hier ein Foto davon. Er ist heute teils gebraucht noch via Ebay erhältlich und reicht wohl bis zum Format 6×6. Dies ist ein Kästlein mit integriertem Blitzgerät und eigentlich eine sehr gute Sache. Denn zudem ist ein zuschaltbares Dauerlicht verfügbar (zum Fokussieren). Der Nachteil: Die Helligkeit des Blitzes lässt sich nicht (herunter-) regeln. Es könnte schon zu stark sein (starkes Abblenden des Makroobjektives führt zu Unschärfen). Aber wenn man so etwas günstig bekommt und vielleicht etwas Freude im Modifizieren hat, wäre dies sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Denn eine Elektronenblitz liefert immer ein hervorragendes weißes Licht (ohne „Einbrüche“ im Farbspektrum) wie eine gute LED-Leuchtplatte. Und der Vorteil des Blitzes ist eben auch, dass man den Raum nicht gegen „vagabundierendes Licht“ abdunkeln muss (weil er eh heller ist als alles störende Umgebungslicht) und man somit bei min. 1/125 Sekunde abfotografieren kann. Jedoch noch ein Einwand: Die Synchronspannung („Zündspannung“) dieses Blitzgerätes betrage offenbar ca. 14 Volt. Für viele moderne Digitalkameras wird dies nicht empfohlen bzw. könnte zum Zerstören dieser führen und man müsste noch einen solchen Adapter dazwischen schalten.
Objektivaufsatz / Dia-Duplizieraufsatz
Diese kleine und simple Vorrichtung zum Digitalisieren von Filmen gibt es bereits seit Jahrzehnten. Früher nutzte man dies zum Verfielfältigen von Dias. Man schraubt den Aufsatz einfach vorne aufs Objektiv in dessen Filtergewinde und schiebt das jeweilige Negativ / Dia hinter die Diffusorscheibe dieses Adapters. Die Kamera wird damit gegen das Licht gehalten und das Negativ / Dia kann somit auf simple Art abfotografiert werden. Der große Vorteil hier: Beides (Film und Objektiv) ist absolut parallel zueinander fest positioniert. Man benötigt hierzu jedoch ein Makroobjektiv oder wenigstens einen (Auto-) Zwischenring. Denn ansonsten kann man nicht so nah fokussieren.
Obacht: Deswegen besitzen viele dieser Diaduplizieraufsätze eine eingebaute „Makrolinse“, also eine Nahlinse. Es sollte klar sein, dass mit solch einer zusätzlichen Nahlinse keine hohe Qualität erreichbar ist. Für diese ist nur ein solcher Vervielfältigungs-Aufsatz ohne integrierte Linse + Makro-Objektiv sinnvoll. Bekannt ist hierbei sicherlich der Nikon ES-2 Negativ- und Diahalter. Dieser passt – dank normalem Filtergewinde – natürlich nicht nur auf Nikon-Objektive. Er wird mit einem Negativstreifen-Halter geliefert sowie mit einem Halter für zwei gerahmte Kleinbild-Dias. Allerdings ist dieser Halter nur für Makro-Objektive mit einer Brennweite von ca. 40 bis 60 mm ausgelegt. Bei einer längeren kann offenbar nicht mehr das gesamte Negativ erfasst werden (ich habe es nicht getestet). Günstigere Alternativen gibt es von Kaiser, Reflecta und mittlerweile auch unter chinesischen Marken. Bei manchen kann man die integrierte Nahlinse heraus nehmen (falls überhaupt vorhanden). Ggf. müssen Adapterringe verwendet werden, damit der Duplikator noch weiter von der Frontlinse weg positioniert werden kann (je nach Brennweite).
Dies ist ein Vorsatz mit Filmstreifen-Halter: Man schraubt ihn vorne direkt auf das Objektiv der Digitalkamera. Fensterlicht durchleuchtet den Filmstreifen gleichmäßig und man kann somit ohne Stativ digitalisieren.
(Man benötigt noch Zwischenringe oder ein Makro-Objektiv, um diese Naheinstellung zu erreichen.)
Solche Aufsätze gibt es offenbar nur für das Kleinbild. Dementsprechend ist dies keine Lösung für Fotofreunde, welche auch „stitchen“ wollen (große Mittelformat-Negative mehrmals in Teilen abfotografieren). Dass sich die Qualität von Tageslicht ständig ändert, sollte hier erwähnt werden. Zudem wird dieses sicherlich häufig zu schwach sein (Sucher dunkel).
Aber man kann einfach das integrierte Blitzgerät der Kamera nutzen oder (besser) einen starken (auch einfachen bzw. manuellen) Aufsteckblitz. Die Kamera mit dem Blitz zeigt / blitzt damit gegen eine weiße Wand und man erhält somit sehr gute Ergebnisse. Zum genauen Fokussieren benötigt man aber immer noch helles Dauerlicht. Wer jedoch das Optimum aus den analogen Aufnahmen heraus holen möchte, muss Sorge dafür tragen, dass sich die Filme nicht wölben: Sie müssen absolut planparallel positioniert sein, was mit solch einem simplen Schieber nur mit Glück funktionieren wird. Bereits bei einer winzigen Verformung des Filmes sitzt dieser nicht mehr im exakten Fokuspunkt. Wir bewegen uns ja hier im Makro-Bereich. Für das Zeigen von 35mm-Filmaufnahmen im Internet oder für mittelgroße Drucke ist die Vorrichtung mit dem Objektivaufsatz natürlich allemal sinnvoll. Wer Mittelformatnegative (siehe auch → Unterschied Kleinbild Mittelformatfilm) oder gar Großformat-Planfilme abfotografieren möchte, braucht einen anderen Aufbau.
Aufsatz mit integrierter Leuchtfläche: VALOI easy35
Der Hersteller ›Valoi‹ hatte jüngst einen interessanten Objektiv-Aufsatz heraus gebracht, welcher auf dem alten Prinzip des „Dia-Duplikators“ basiert. Schauen Sie sich hierzu dieses Video an:
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
Das Gerät besitzt eine integrierte Leuchtfläche und wird, wie gewohnt, vor ein Makro-Objektiv geschraubt. Es ist nicht gerade günstig, verspricht jedoch ein recht elegantes und komfortables Digitalisieren von Kleinbildfilmen ohne Friemelei.
Makroschiene und LED-Leuchtfläche nutzen
Als eine weitere Lösung empfiehlt sich eine Makroschiene. Auf dieser ist die Kamera geschraubt sowie zusätzlich noch ein LED-Panel. Hierdurch ist man vom Fensterlicht unabhängig und erhält immer gleiche Ergebnisse. Die gesamte Konstruktion passt bequem auf den Schreibtisch bzw. gleich neben den Laptop, auf welchen die Bilder übertragen werden. Zudem ist die LED-Leuchtfläche bei diesem Abstand sehr hell, wodurch kurze Belichtungszeiten möglich sind. Ein kleines Stativ erleichtert das Abfotografieren auf dem Schreibtisch.
Dies ist eine sehr elegante Vorrichtung mit den Nachteilen, dass man damit eben nicht stitchen kann und dass die Filmnegative eventuell nicht ganz genau plan positioniert werden können (im simplen Plastikhalter).
Verwendet wurden hier Komponenten wie:
- eine Makro-Schiene zum Halten und Verschieben der beiden Komponenten
- ein LED-Panel mit hohem CRI-Wert (falls Farbfilme digitalisiert werden sollen)
- ein einfacher Filmhalter
- ein Tischstativ mit Kugelkopf
Dieser minimalistische Aufbau ist sicherlich für die Meisten bereits ausreichend und schreibtischfreundlich. Man kann mit dieser Vorrichtung auch Mittelformat-Negative abfotografieren. Hierfür müsste man sich aber irgendwie einen speziellen Halter anfertigen (lassen), so wie einen solchen:

Dieser Halter stammt aus dem 3D-Drucker.
Dies ist eine günstige Durchlichteinheit mit integriertem Filmhalter: Man schiebt zum Digitalisieren den Filmstreifen hinein und positioniert die Kamera mit dem Makro-Objektiv davor.
Stativ oder Reproständer?
Da ich am liebsten mittels einer Buchbildbühne Negative abfotografiere, nutze ich dementsprechend eine Leuchtfläche darunter. Also ist mein Aufbau ein vertikaler: Die Kamera schaut von oben auf den Film hinunter. Hierbei muss sie natürlich entsprechend fest positioniert werden können. Ich nehme hierzu bevorzugt ein einfaches Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule, dass ich auch für andere Zwecke nutze:

Die Beine lassen sich weit abspreizen, die Mittelsäule kann man heraus ziehen bzw. umdrehen, dass die Kamera unten sitzt:

Ein kompaktes Reisestativ inklusive Kugelkopf. Durch den Trick, dass sich der Kopf beim Zusammenlegen innerhalb der Beine befindet, erhält man ein Packmaß von nur 35 cm! Weiterhin lässt sich ein Stativbein als Einbeinstativ umfunktionieren. Bei Amazon gibt es dieses kompakte und stabile Stativ zum gewohnt günstigen Preis.
Diese Stative sind von den Markenherstellern ziemlich teuer. Ich nutze seit über 10 Jahren billige Nachbauten. Seit einigen Jahren werden hier recht gute und dabei günstige Produkte angeboten. Wenn man nicht gerade mit dem Auto darüber fahren möchte, taugen auch diese durchaus – erst recht natürlich im Wohnzimmer für das Abfotografieren von Filmen von der Leuchtplatte. Auch der Kugelkkopf ist hier sehr praktisch bzw. entsprechend stabil. Einen Kugelkopf würde ich hier für die exakte Ausrichtung der Kamera immer einem 3D-Neiger bevorzugen.

Diese Stative sind recht universell, was deren Funktionen angeht, da sie sich sehr gut zerlegen- und variabel verstellen lassen (hier eines von Triopo). Hierdurch sind verschiedene Aufbauten realisierbar.

Für die Reproduktion einer solchen Vorlage muss man die Mittelsäule vom Stativ nicht zwingend drehen können. Ein leicht gekippter Aufbau funktioniert auch, wenn sich die Stativbeine genügend weit spreizen lassen. Ist dies nicht der Fall, droht ein Umkippen. Allerdings kann man auf diese Weise die Kamera schlecht in der Höhe korrigieren. Hierzu braucht man dann unbedingt noch ein solches Zubehör:
Eine Sache wäre bei meiner Vorrichtung mit dem Stativ noch wünschenswert: Hätte ich noch eine Makroschiene mit einstellbarem Lauf, so könnte ich diese zusätzlich anbringen und so ganz elegant die Höhe justieren. Bisher tätige ich dies mittels Verstellen der (umgedrehten) Mittelsäule.
Solch eine Makroschiene besitzt eine fein einstellbare Positionierung: Somit kann die Kamera präzise in der Höhe verstellt werden, bis das Objekt tatsächlich gerade so formatfüllend abgebildet werden kann.
Eine bessere Lösung wäre jedoch ein Reproständer:
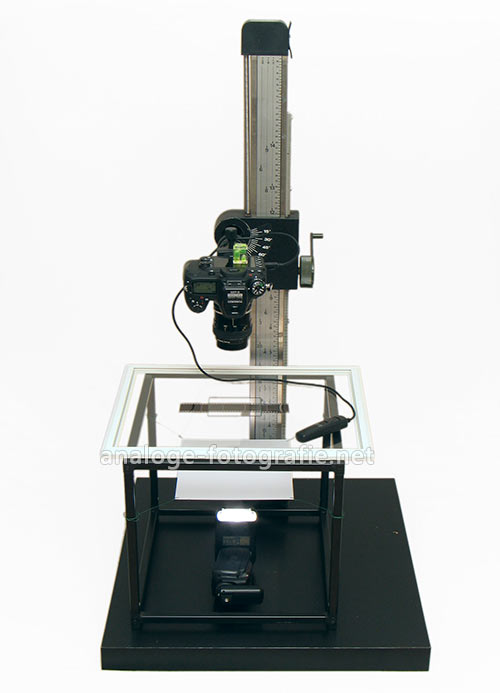
Auf dieser Abbildung (mit meiner selbst gebauten Blitzbox) nutze ich einen solchen – Es ist einfach die Säule und die Grundplatte meines Vergrößerers! Die Vorteile: Es gibt keine störenden Stativbeine und: Man kann die Kamera ganz elegant mittels Kurbel in der Höhe verstellen.
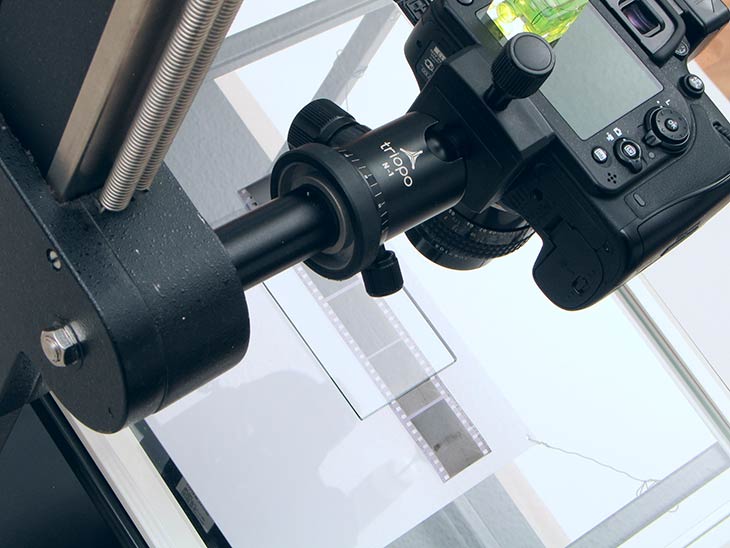
Die Kamera bzw. der Kugelkopf wird mittels einem kurzen Verbindungsstück an der Säule des Vergrößerers befestigt. Dieses Verbindungsstück war bei meinem Stativ dabei und es besitzt hinten ein Gewinde für eine Schraube.
Reproständer gibt es natürlich auch neu zu kaufen– oft gleich mit Kameraanschluss:
Professionelle Kopie Stand A mit Aluminiumständer Einziger Bolzen auf dem Brett, Brettgröße 40x45cm, nur vertikaler Schuss Schnell Release-Pad für die Kamera Standard-Schraubgewinde-Kamerahalterung, passend für die meisten Point & Shoot-Kameras und DSLR-Kameras Empfehlen Sie dem Benutzer, eine Verschlusssteuerung (Kabel oder Elektrogerät) zu verwenden, anstatt den Kamerablenden der Fingerpre...
Eine günstige Alternative wäre hierfür auch der Reprostativ V5 Bausatz von DOLD Mechatronic. Allerdings gibt es dort nicht die sehr komfortable Zahnstangenmechanik, mittels welcher die Kamera bequem und genau in der Höhe verstellt werden kann. Dies lässt sich jedoch mit einer verstellbaren Makroschiene umgehen.
Die Haltevorrichtung der Kamera wurde nun besprochen. Nun widme ich mich dem Licht und den Filmhaltern. Danach geht es um das richtige Aufnahmeobjektiv.
Abfotografieren von der Leuchtplatte
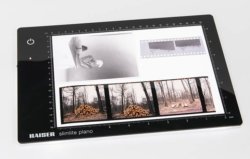
Eine Leuchtplatte von Kaiser. Es fehlt noch der Filmhalter, denn die meisten Filme wölben sich und kommen so ganz schnell aus dem minimalen Schärfebereich des Aufnahmeobjektives.
Die für mich sinnvollste Variante ist das Abfotografieren von Negativen und Dias direkt von der Leuchtplatte. Warum?
- Der Film kann bei einer solchen Vorrichtung absolut plan positioniert werden – weil er eben bzw. horizontal ausgerichtet ist.
- Dadurch ist das Stitchen durch einfaches Verschieben der Leuchtplatte möglich (ein Mittelformatnegativ kann mit der Digitalkamera mittels mehreren Aufnahmen sozusagen gescannt werden).
- Der Film kann mittels dem Spiegeltrick tatsächlich planparallel zum Objektiv ausgerichtet werden, bzw. man kann dies auch prüfen.
- Moderne Leuchtplatten besitzen einen integrierten Akku, wodurch keine Kabel stören. Allerdings besitzen nur wenige Modelle einen genügend hohen CRI-Wert, welcher bei einer realistischen Farbwiedergabe eine Rolle spielt. Was dieser Wert ist, erkläre ich gleich im Anschluss.
Die Vorgehensweise ist hier zunächst schnell erklärt:
- Man positioniert das Dia / das Negativ auf der Leuchtplatte.
- Die Kamera befindet sich an einem Stativ mit drehbarer Mittelsäule oder an einer Reprosäule.
- Man fotografiert den Film mittels Makro-Objektiv oder wenigstens mittels Zwischenring + Standardobjektiv ab.
Auf die Tücken hierbei soll nun genauer eingegangen werden. Diese Tipps und Hinweise spielen teils auch für die anderen Vorrichtungen für das Abfotografieren von Film eine Rolle. Zunächst sollen noch einige Worte zur Leuchtfläche selbst verloren werden:
Welche Lichtquelle ist zum Abfotografieren geeignet?
Etwas weiter oben wurde ja der Dia-Duplikator-Vorsatz vorgestellt, welcher nichts weiter ist als ein einfacher Objektiv-Vorsatz. Idealerweise richtet man diesen gegen den bewölkten Himmel und hat mit dieser „Naturlicht“ Lichtquelle tatsächlich ein sehr gutes, d. h. neutrales, Licht ohne „Farb-Peaks“ – Es wird allerdings recht schwach (dunkel) sein und kann sich schnell wieder verändern.

Leuchtplatte von Kaiser mit Filmkassette und Haltern
Solch ein neutrales Tageslicht muss also durch ein künstliches Leuchtmittel simuliert werden. Ich würde hierzu als Lichtquelle keine billige Leuchtplatte nutzen, denn diese sind nur zum Betrachten gedacht oder zum Abpausen und dergleichen – nicht aber für ein farbneutrales Reproduzieren. Drei Merkmale sind hier wichtig:
- die Farbtemperatur in Kelvin sowie
- der CRI-Wert („Farbwiedergabeindex“)
- genügende und konstante Helligkeit
Der erste Wert sollte zwischen 5000 bis 5600 Kelvin liegen. Dann entspricht die Lichtfarbe ungefähr der des Tageslichtes – also weiß. Kamerasensoren besitzen vermutlich insbesondere bei solch „weißem“ Licht die bestmögliche Farbdynamik. Für die Reproduktion von Farbmaterial reicht dies aber noch nicht:
Der CRI-Wert sollte (theoretisch) möglichst hoch sein. Meine Kaiser-Leuchtplatte besitzt einen von 95 (von 100). Auf einfach gesagt: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI-Wert) gibt an, dass es im zusammengesetzten Licht keinen „Peak“ gibt, dass also alle Farben gleichmäßig vorhanden sind (weißes Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen). Ist dies nicht der Fall, könnten Farben beim Abfotografieren nicht gescheit separiert werden: Man übergibt eine bereits verzerrte oder „grobe“ Digitalisierung an die spätere Bildbearbeitung. Da hilft auch kein Weißabgleich. Durch einen hohen CRI-Wert ist es möglich, dass Tonwerte sauber voneinander getrennt digitalisiert werden können: Dass beispielsweise die Orange-Maske eines Farbnegativfilmes neutralisiert werden kann, ohne dass blaue Töne im Motiv (im Negativ Orange) darunter leiden bzw. nicht korrekt digitalisiert werden. Hier bin ich nicht ganz sattelfest. Wer mehr hierzu weiß, kann gerne die Kommentarfunktion nutzen.
Die Kaiser Slimlite plano ist eine Leuchtplatte mit Tageslicht-Farbtemperatur und hohem CRI-Wert (95). Es gibt hier kein Raster auf der Oberfläche. Daher wird sie insbesondere zum Abfotografieren von Dias oder Negativen empfohlen. Natürlich kann man sie (es gibt drei Größen) auch zum Betrachten mit starker Lupe einwandfrei nutzen. Sie besitzt auch einen integrierten Akku und lässt sich dimmen.
Wer jedoch nur S/W-Negative digitalisieren möchte, für den spielt der Farbwiedergabeindex freilich keine Rolle und hier reicht dann sicherlich auch ein günstiges Leuchtpad bzw. eine Lichtquelle, die einfach nur gleichmäßig hell und einigermaßen weiß ist. Obacht: Diese sollte aber eine Oberfläche ohne feinem Raster besitzen.
Ich hatte den Vergleich gewagt: Alte, günstige Leuchtplatte mit Neonröhren gegen eine moderne LED-Leuchtplatte mit hohem CRI-Wert: Die Unterschiede der Farben sind bei meinem Testnegativ eher marginal. Aber man sieht sie: Manche Farben sind bei der Aufnahme von der einfachen Leuchtplatte einfach nicht satt genug wieder gegeben. Sie wirken etwas blass. Die Orange-Maske konnte jedoch bei beiden Produkten später erstaunlicherweise gleich gut weggefiltert werden. Dass die alte Leuchtplatte flackert und keinesfalls gleichmäßig ausleuchtet, darf jedoch auch nicht verschwiegen werden. Dennoch: Innerhalb der Kataloge und Fachzeitschriften wird gerne mit Werten (Laborwerten) hantiert – auch was andere fotografische Eigenschaften (Objektivtests sind das beste Beispiel) angeht. Für die fotografische Praxis spielen diese häufig gar keine so große Rolle, wie es gerne weiter erzählt wird (z. B. auch in Internetforen). Meiner Meinung (bzw. meines Tests nach) gilt dies auch für diesen ominösen CRI-Wert. Trotzdem ich meine redaktionelle Arbeit auch durch etwas Reklame finanziere, erwähne ich dies dennoch an dieser Stelle aber empfehle weiterhin die besseren Leuchtplatten. Diese sind ja auch gut und vor allem gleichmäßig ausleuchtend – Ich benutze selbst eine solche. Wenn bei Ihnen Schmalhans Küchenmeister ist, nehmen Sie einfach eine günstige Version. Vermutlich wird der Unterschied auch bei Farbfilmen nicht so groß sein, wie häufig kolportiert.

War die Lichtquelle beim Abfotografieren neutral, erhält man auch neutral ausfilterbare Digitalisierungen vom Farbnegativ mit differenzierten Farben – wie bei diesem an sich eher kniffeligen Herbstbild.
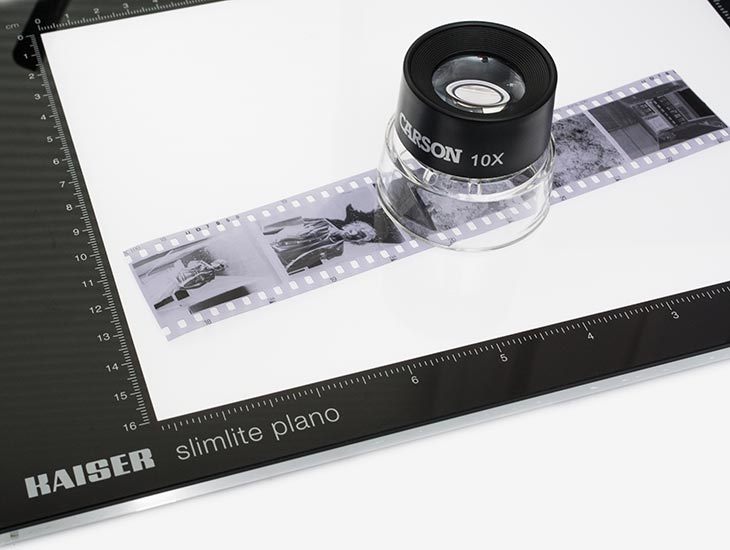
Mit einer Leuchtplatte und einer genügend starken Negativlupe kann / sollte man natürlich auch die Filme auf Schärfe prüfen – bereits vor dem Digitalisieren. Ich kontrolliere meine Filme immer vor dem Vergrößern im Labor bzw. vor dem Digitalisieren mit solch einer Lupe. Eine Vergrößerung von x10 reicht hier auch bei Kleinbildfilmen aus. Die günstigen Modelle weisen Verzerrungen an den Rändern auf. Da man damit jedoch nur die Schärfe kontrollieren möchte (in der Mitte des Sichtfeldes) spielt dieser Makel keine große Rolle.
Es gibt auch günstige LED-Videolampen mit hohem CRI-Wert! Auf diese kann man natürlich keinen Film auflegen (weil die Oberfläche nicht homogen leuchtet). Aber man kann diese an eine Makroschiene montieren und erhält einen Abstand oder aber man legt eine (neutralweiße) Plastikscheibe als Diffusor direkt obenauf und baut sich einen Rahmen, welcher einen Abstand zum Negativ gewährt. Dann steckt man aber wieder in der Bastelei fest bzw. hat ggf. ein Provisorium.
Sehr gut für Farbreproduktionen (d. h. für das Abfotografieren von Dias / Farbnegativfilm) sind auch die guten alten Halogenlampen geeignet. Manch einer nimmt einfach seinen Vergrößerer als Lichtquelle bzw. lediglich den Diffusor-Kopf und dreht ihn um, dass die Bildbühne direkt auf den Diffusor gelegt werden kann. Auf dieser Seite sehen Sie ein Foto von solch einer Konstruktion. Alte Vergrößerer mit simpler Opal-Glühlampe sind hierfür nicht geeignet (für S/W-Filme natürlich schon).
Für mich heißt dies nun: Man braucht als Lichtquelle starkes Kunstlicht entweder von
- einem Halogenleuchtmittel oder
- einem Blitzlicht oder
- einer guten (!) LED-Leuchtfläche.
Ich habe einmalig in eine gute Leuchtplatte investiert und mache mir keine Gedanken mehr ums Licht.
Folgende Hinweise hatte ich in einem englischsprachigen Forum zum Thema Lichtqualität für die Digitalisierung von Farbnegativen gefunden:
Recommended LED Panels:
Skier Sunray Copy Box II 2.9k – Great system. 97 CRI light that is bright and even, and includes film holders for a variety of sizes that keep film flat and elevated off the surface.
Kaiser Slimlite Plano (CRI = 95, very even)
iPhone or iPad, especially newer models with OLED (must elevate film off surface!). While the reported CRI is not high, it has spectral sensitivity curves more similar to film paper, resulting in less color interference from the orange mask. It is also a more “collimated” source of light, meaning it will produce sharper results than diffuse light sources.
Any modern Samsung Galaxy/Galaxy Note s7, s8, s9, pixel 3, etc
Walimex Pro LED (CRI = 90)
Hat man also bereits ein modernes Apple- oder Samsung-Tablet mit „OLED“ Display, sollte man ein solches einmal zum Durchleuchten testen (nicht vergessen, einen glatten Diffusor mit Abstand dazwischen legen). Sollten Sie allerdings nur S/W-Vorlagen mit der Digitalkamera abfotografieren wollen, ist die Lichtqualität allerdings weniger kritisch.
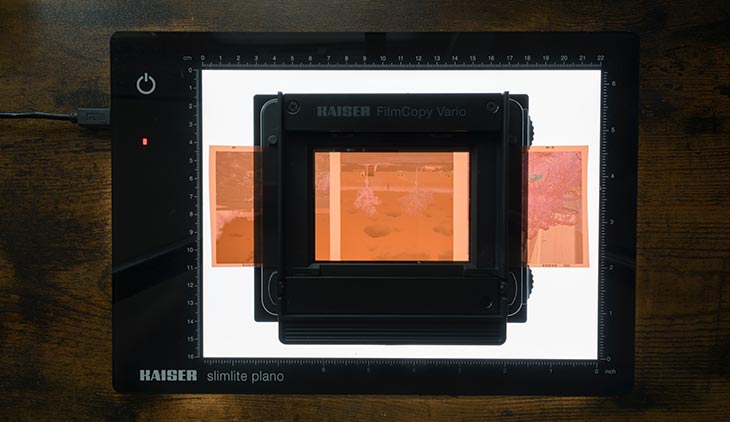
Hinweis: Man sollte den Bereich um das abzufotografierende Negativ / Dia abschatten bzw. eine Maske nutzen. Auf dem oberen Foto ist dies nicht getan worden. Was könnte passieren? Die Kamera darüber wird somit durch diese Leuchtfläche angestrahlt: Sie könnte sich daher im Film bzw. im Glas des Filmhalters spiegeln.
Die Filmhalter

Die Auswirkungen kann man übrigens auch live auf dem großen Computermonitor kontrollieren. Man nennt diese Technik Tethering.
Ein zu digitalisierendes Negativ oder Dia sollte möglichst
- parallel zum Objektiv / zur Kamera und
- plan (d. h. glatt)
positioniert sein. Parallelität und Ebenheit sind bereits beim Scannen wichtige Kriterien, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie hoch aufgelöst die Ergebnisse später auf dem Computermonitor erscheinen werden! Dies wird häufig vernachlässigt und man sucht Fehler in der Hardware oder in der Software. Kümmert man sich nicht um diese Planarität, verschenkt man häufig das Potential von an sich hoch aufgelösten analogen Fotografien. Da ist es dann auch egal, wie hochwertig die restliche Technik ist. Mit einem gescheiten Filmhalter bekommt man dies jedoch in den Griff. Nur Planfilme würde ich direkt auf die Leuchtplatte auflegen. Diese waren in ihrem Leben nie gerollt und sind zudem dicker als Rollfilme. Sie liegen, wie der Name es schon sagt, plan. Eine simple (und nachbestellbare) Lösung für einen solche Filmhalter sind zunächst jene von Scannern:
Filmhalter aus Scannern

Dies sind einfache Plastikrahmen, in welchen der Film gelegt wird. Diese Filmhalter lassen sich für diverse Scanner nachbestellen. Man legt sie einfach auf das Leuchtpult. Abgebildet ist hier der Kleinbildfilmhalter vom Epson V750 Scanner. Mittlerweile gibt es hierzu bessere: Sie besitzen eine Scheibe (Antinewton-Glas) oberhalb. Diese sorgt bei sich nach oben wölbenden Filmen dafür, dass diese tatsächlich plan gehalten werden. Dies kann bei „normalen“ Filmhaltern passieren:
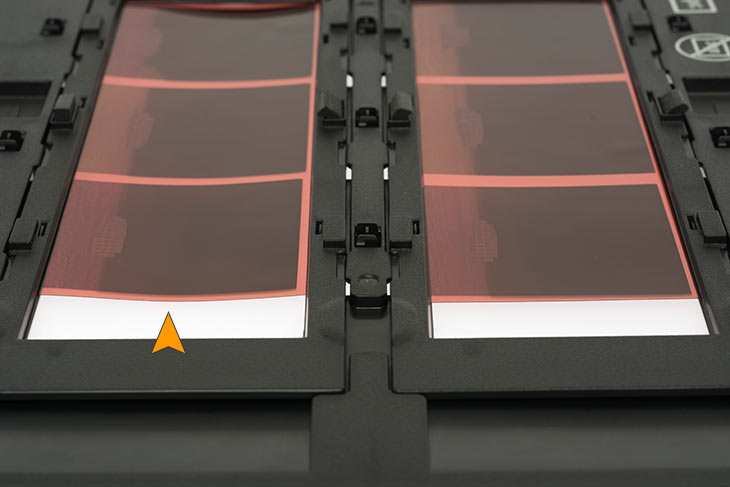
Insbesondere Mittelformat-Filmstreifen neigen zum Durchhängen! Passiert so etwas, ist der gesamte, mit Bedacht eingerichtete Aufbau zum Abfotografieren für die Katz: Das Negativ kann einfach nicht durchgehend scharf digitalisiert werden. Bessere Filmhalter besitzen Stege: Zwischen jedem Einzelbild befindet sich ein Steg. Sie reduzieren ein Durchhängen wirkungsvoll. Allerdings braucht man dann auch Filme mit absolut gleichmäßigen Bildabständen. Sonderformate kann man damit nicht scannen. Die Firma Better Scanning bietet gute Masken mit verstellbaren Stegen an.
Lomography Digitaliza
Viele Fotofreunde nutzen als Filmhalterung den „Digitaliza“ der Firma Lomography:

Der DigitaLIZA (Eigenschreibweise) ist eigentlich ein klasse System: Der Filmstreifen wird eingelegt und mittels dem „Stempel“ nach unten, also plan, gedrückt. Während man diesen noch hält, klappt man die obere Maske nach unten und diese schnappt fest ein – denn sie hält magnetisch. Nun entfernt man das Stempelteil und der Film sitzt straff und einigermaßen plan. Zudem sind die Perforationslöcher nicht abgedeckt (nur bei der Kleinbildversion).
Der Lomography Digitiliza ist eine Filmmaske (in zwei Versionen: 35 mm Kleinbild oder Mittelformatfilm) mit einem Magnetsystem: Die Filme werden durch eine magnetische Maske fixiert. Hierbei sind der Filmrand und die Perforationslöcher noch sichtbar / scanbar.
Während man den Digitaliza nun anhebt, fällt gleich dir untere Metallplatte ab und man hat eine recht brauchbare Halterung für einen Filmstreifen:

Möchte man diese zum Scannen nutzen, sollte man unten genau hohe Abstandhalter anbringen. Für das Abfotografieren auf dem Leuchttisch braucht man diese natürlich nicht, da man die Fokussierung hier mit dem Objektiv erledigt. Diese Filmhalterung von Lomography gibt es entweder für das Kleinbild (hier abgebildet) oder für den 120er Rollfilm.
Ich hatte mir diese Filmmaske damals gekauft, weil ich annahm, dass es durch dieses magnetische Klappprinzip in Kombination mit dem Stempel tatsächlich möglich ist, Negative in eine plane Form zu zwingen. Dies hatte bei mir nicht funktioniert. Die Fläche der Filmränder, auf die der Rahmen wirkt, ist einfach viel zu dünn, dass der Film straff gehalten werden kann. Er wölbte sich bei mir dennoch leicht. Diese Lösung ist also auch nicht das Gelbe vom Ei.
Masken aus dem 3D-Drucker
Mit jedem 3D-Drucker lassen sich Halterungen für die unterschiedlichsten Filmformate anfertigen bzw. man kann sie selber bauen:

Dieses Prinzip ist schon viel besser: Denn nun wird lediglich ein einzelnes Bild freigegeben anstelle ein ganzer Filmstreifen. Dadurch kann sich der Film schlechter wölben / kann schlechter durchhängen, da er viel enger eingefasst ist. Zudem wurde hier noch ein Milchglas (Acrylscheibe) hinten zum Andrücken montiert. Die abgebildete Version ist für das 6×6-Mittelformat geeignet.
Die Abbildung hat mir ein Fotograf freundlicherweise überlassen. Ich selbst besitze diese Filmhalterung nicht und kenne mich mit 3D-Druckern auch nicht aus. Ich habe für diesen Halter auch keine Druckdaten. Der Halter ist für die horizontale Montage auf der Makroschiene gedacht. Offenbar kann man so etwas so drucken, dass tatsächlich ein rechter Winkel entsteht bzw. dass die Filmhalterung auf der Makroschiene parallel zum Objektiv platziert wird (verlassen würde ich mich darauf nicht). Denn dies ist ja wichtig. Sicherlich könnte man sich so etwas auch drucken (lassen) für eine horizontale Position auf der Leuchtplatte.
Eine Druckvorlage für das Auflegen auf eine Leuchtplatte jedoch ist sicherlich schnell gedruckt und eine solche finden Sie hier. Ich fand auch noch eine andere Version. Eine gescheite Planlage des Filmes dürfte hierbei allerdings kaum möglich sein.
Eine noch viel bessere Lösung fand ich hier:
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
Der „RODSGEAR“ (Eigenschreibweise) ist ein variables System (Kleinbild + Mittelformat). Das Besondere zudem: Es kann eine Roll-Vorrichtung gedruckt werden zum schnellen Bildwechsel. Die Druckdaten hierfür finden Sie hier. Der Erfinder hat die Vorrichtung sogar motorisiert.
Der pixl-latr Rahmen mit Andruckblöcken
Ein ebenfals durchdachtes System wird von pixl-latr (Pixellator) angeboten: Hierbei handelt es sich um einen Rahmen, in welchen der Filmstreifen gelegt wird. Auf der Rückseite befindet sich eine weiße Acrylscheibe als Diffusor und Andruckfläche. Nichts Neues also.

Foto: pixl-latr
Zusätzlich werden vorne Blöcke eingeschoben (genannt „gates“), die nur das tatsächliche Bild freigeben. Das heißt: Der Filmstreifen wird zunächst von hinten durch die Acrylscheibe an den Rahmen gepresst. Die Blöcke pressen ihn wiederum von vorne an die Scheibe. Nur das tatsächliche Bild wird freigelassen. Hierdurch kann ein Durchhängen / Wölben wirksam minimiert werden. Das ganze legt man dann auf die Leuchtplatte. Ein simples wie auch cleveres System. Natürlich ist es nicht für das schnelle Durchziehen vieler Bilder gedacht.
EFH Essential Film Holder
Der „Essential Film Holder“, kurz EFH, ist ebenfalls ein nur für das Abfotografieren gedachter Filmhalter: Unten gibt es eine transparente Andruckplatte. Darauf wird der Negativstreifen gelegt. Darüber wird eine passende Maske geschraubt: Der Film hängt nicht durch und ist durch den genauen Maskenausschnitt auch kaum in der Lage, sich nach oben zu wölben.
Sie können sich das Pronzip auf der Website von EFH ansehen. Offenbar wird der Filmhalter in kleiner Manufakturarbeit in Großbritannien gefertigt und man müsste ihn sich von dort auch liefern lassen. Zudem gibt es für mehrere Filmformate passende Masken, damit möglichst viel Fläche des Filmstreifens nach unten gedrückt werden kann (Verhindern von Wölbungen). Es ist also das selbe Prinzip wie beim eben erwähnten pixl-latr.
Übrigens: Ein engagierter Leser hatte mir in den Kommentaren seine Erweiterung für den EFH vorgestellt: Er druckt sich mit dem 3D-Drucker einfach einen Tubus, welcher auf dem EFH (also auf dem Filmhalter) aufsitzt. Auf dem Tubus wird die Kamera bzw. das Makroobjektiv geschraubt. Dadurch benötigt man zum einen keine Reprosäule mehr und das parallele Ausrichten entfällt ebenfalls. Durch den Tubus wird zudem das Umgebungslicht ausgesperrt. Edit: Leider sind die Druckdaten nicht mehr verfügbar. Ich habe sie jedoch sicherheitshalber abgespeichert. Meie E-Mail-Adresse befindet sich im Impressum (Link ganz unten auf dieser Seite).
Negative Supply Filmhalter
Die Firma Negative Supply aus den USA stellt ein besonderes System vor: Einen Filmhalter für ungeschnittene Filme. Das heißt: In die Kassette wird ein ganzer entwickelter Film eingelegt und Bild für Bild mittels Drehknopf bewegt. Diese Kassete „Film Carrier“ steht dabei auf einer Leuchtplatte. Es gibt hierfür eine Version für das 35 mm Kleinbildformat, eine für 120er Rollfilme und mittlerweile auf für weitere Filmformate. Wie dies ausschaut, kann man auf der Internetseite des Herstellers sehen oder auf diesem Video:
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
Hier geht es um Geschwindigkeit, darum also, einen ganzen Film möglichst schnell digitalisieren zu können. Und wo es schnell geht, wird vermutlich wiederum die Planlage leiden (es gibt keine Andruckfläche). Aber ich habe das System nicht ausprobiert. Es ist recht teuer und man muss es sich wohl aus Amerika liefern lassen*. Ganze Filmstreifen kann man auch durch eine Buchbildbühne (hierzu gleich mehr) schieben. Negative Supply bietet auf deren Internetseite auch noch viele andere nützliche und interessante Produkte zum Thema Digitalisieren von Film an, allerdings zu recht hohen Preisen.
*Es gibt derzeit einen Vertrieb in Deutschland durch Fotoimpex.
Valoi 360
Ähnlich wie das eben vorgestellte „Negative-Supply-System“ ist das „Valoi-360-System“. Mitels drehen wird der Filmstreifen transportiert. Es gibt hier diverse Masken, um die Filme plan zu halten (fürs Kleinbild, Mittelformat, …):
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
Dieses Gerät stellt man einfach auf eine Leuchtplatte. Zusätzlich kann eine Anti-Staub-Bürste angebracht werden. Valoi 360 scheint mir ein cleveres System zu sein. Inwiefern diese Produkte hier in Deutschland vertrieben werden, weiß ich allerdings nicht.
Tipp: Manch einer bastelt sich so etwas selber – Suchen Sie einmal nach dem „Kaiser Diacut“ (allerdings offenbar nur fürs Kleinbild verfügbar). Vom Prinzip her ist dies ganz ähnlich. Allerdings müsste man die Leuchteinheit wechseln (LED wegen hohem CRI-Wert). Den Tipp hatte ich aus einem Forenbeitrag.
Die Skier Sunray Copy Box
Eine weitere, sehr interessante Lösung wäre die sogenannte „Sunray Copy Box“ der Firma Skier: Dies ist ein Holzkästchen mit bereits integrierter Leuchtplatte (Anschluss an die Steckdose). Diese kompakte Lichtbox besitzt einen hohen CRI-Wert von 95 (Farbwiedergabeindex). Dies bedeutet, auf einfach gesagt, dass sich das weiße Licht aus gleichmäßig anteiligen Farben zusammen setzt – wie das Tageslicht der Sonne. So etwas ist für korrekte Digitalisierungen von Farbfilmen wichtig, nicht aber für S/W-Filme. Etwas weiter oben schrieb ich bereits etwas zum Farbwiedergabeindex.
Die kleine Box aus Bambusholz hat oben einen Filmhalter / Maskenhalter für entweder Kleinbildfilm (36 x 24 mm) oder für das Mittelformat (bis zum Format 6 x 9). Auch gerahmte Dias lassen sich einsetzen.
Der Vertrieb in Deutschland ist allerdings recht eingeschränkt (derzeit 3 bis 4 Wochen Wartezeit). Zudem hat die Box ihren Preis. Da glaslose Rahmen genutzt werden, hat man zwar ein Staubproblem weniger. Die höchste planparallele Qualiät erreiche ich jedoch mit Glaseinsätzen in einer Buchbildbühne über einer Leuchtplatte mit ebenso hohen CRI-Wert:
Eine Buchbildbühne verwenden
Sie haben es ja schon gemerkt: Ich digitalisiere meine Filme nicht nur, ich vergrößere meine S/W-Nagative auch in der eigenen Dunkelkammer. Warum ich so viel über das Abfotografieren weiß? Weil viel Wissen hierbei durch meine Erfahrungen im Fotolabor entstanden ist. Denn der Vorgang des Vergrößerns von Negativen in der Dunkelkammer ist sehr ähnlich dem des Abfotografierens von Film. Im Labor nutze ich einen Vergrößerer und folgendes Teil:
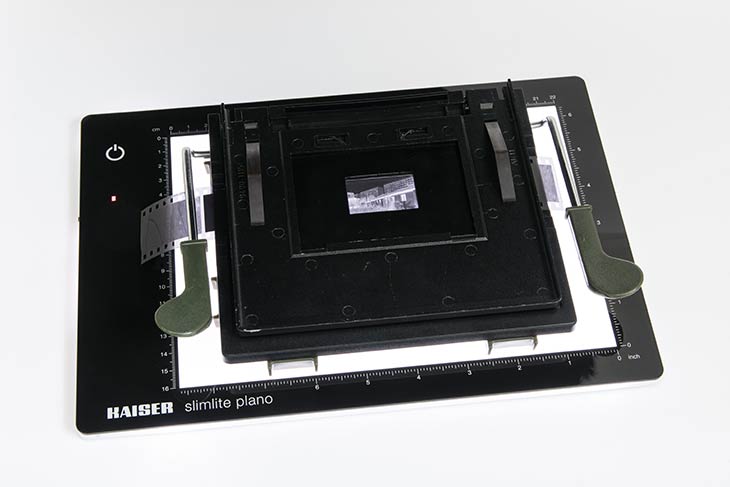
Dies ist eine sogenannte Buchbildbühne. Sie wird normalerweise in den Vergrößerer geschoben.
| | | | | | | | | | |
| Die sieben Todsünden der Fotografie: Reflexionen und Wege zu besseren Bildern | Plustek OpticFilm 8200i SE 35mm Dia/Negativ Filmscanner (7200 dpi, USB) inkl. SilverFast SE | Analog fotografieren: Der praktische Einstieg | Andreas Feiningers große Fotolehre | Starter Kit für die S/W-Fotopapier-Entwicklung | DGODRT Diascanner, Mobile Film Scanner, Scannen und Speichern Ihrer 24x36 mm Negative und Dias mit Smartphone-Kamera, Faltbarer Tragbare Filmscanner mit LED-Beleuchtung | Analoge Fotografie: Stand 2019: Kameras und Objektive, Ausrüstung und Material, Entwicklung und Inspiration | 80er Jahre Vintage Kodak Logo - schwarz T-Shirt | Lomography Konstruktor DIY Kamera | Rollei DF-S 180 Dia-Film-Scanner |
| € 24,90 | € 345,41 | € 32,90 | € 14,99 | € 89,99 | € 12,99 | € 39,90 | € 18,49 € 15,71 | € 51,10 | € 39,99 |
 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| auf Amazon ansehen | auf büroshop24 ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Foto Erhardt ansehen |

Und der eingelegte Film kann dann auf Fotopapier projiziert werden. Das alles interessiert an dieser Stelle nicht. Interessant ist aber, was so eine Bildbühne kann:

Ich nutze am liebsten meine Kaiser Filmcopy Vario Bildbühne (leider nicht gerade günstig, aber sehr gut und mit allem Zubehör neu zu erwerben). Auf dem Foto sind bereits die optionalen Glaseinlagen abgebildet, auf die ich gleich zu sprechen komme. Man setzt die Buchbildbühne direkt auf die Leuchtplatte auf. Die mitgelieferte Matte schattet alles andere ab, damit nichts blendet. Für diese Buchbildbühne werden diverse Masken angeboten. Abfotografiert werden kann hierbei alles vom winzigen Minox-Bild, über das Format 110, APS, Disc-Film, bis zum Format 6×8 Mittelformat bzw. Panorama (falls es keine Maske gibt, nimmt man die optionalen Glaseinsätze). Diese Einzelbildmasken haben den Vorteil gegenüber langen Filmstreifenmasken, dass hier das berüchtigte Durchhängen vermindert werden kann. So schaut dies dann in der Praxis aus:

Hier wurde die Maske für ein 35mm Diafilm im Rahmen in die Buchbildbühne eingelegt. Nichts wackelt, alles ist präzise ausgerichtet. Es gibt kein störendes Fremdlicht. Die Leuchtplatte steht fest auf dem Tischlein und die Bildbühne ebenso darauf. Ein Vorteil solcher Bildbühnen: Da hier durch die Masken nur das Licht genutzt wird, welches benötigt wird, kann kein Licht am Negativ „vorbei strahlen“: Man reduziert hierbei etwaige Kontrastfehler bzw. ein Schimmern.
Die Kaiser Filmcopy Vario ist eine Buchbildbühne bis zum Format 6x8. Durch die Masken (fürs Kleinbild sind bereits zwei Typen enthalten) lassen sich viele Filmformate plan einlegen bzw. fixieren. Man benötigt nur noch eine Leuchtplatte, auf die die Bildbühne (und die Matte) aufgelegt wird.
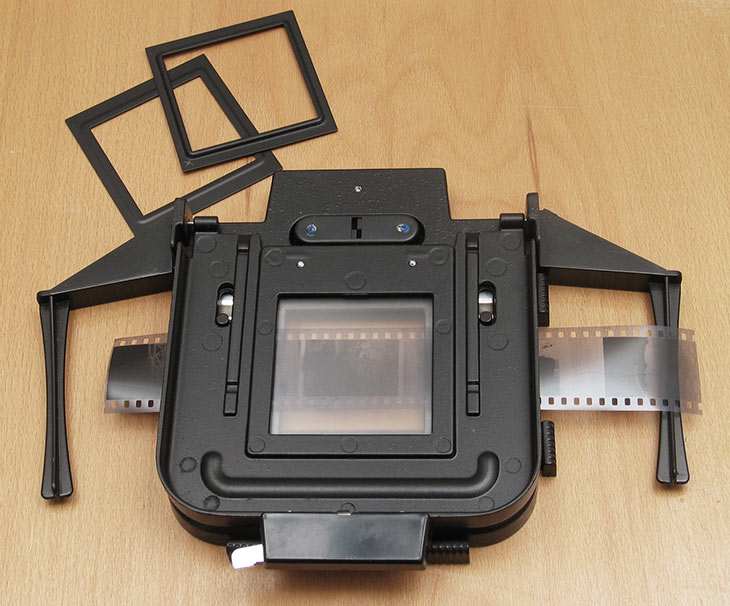
Tipp: Wenn bei Ihnen Schmalhans Küchenmeister ist und Ihnen die neuen Kaiser Buchbildbühnen nebst optionalen Masken zu teuer sind, dann schauen Sie bei Ebay einmal nach gebrauchten Bildbühnen für Vergrößerer. Wichtig hierbei: entsprechende Gläser bzw. Masken sollten dabei sein. Abgebildet ist hier eine Buchbildbühne vom „Meopta Opemus 6“ Vergrößerer mit AN-Glas / Klarglas sowie zwei Glaslos-Masken für das Format 6×6. Obacht: Auf der Unterseite müssen Pads oder dergleichen montiert werden, damit das Metall die Oberfläche der Leuchtplatte nicht zerkratzt! Und sie muss dabei plan liegen können. Bei der Kaiser Bildbühne wurde hierbei extra eine schwere Metallplatte montiert, welche weiche Kunststofffüße besitzt.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Durst Nevoneg Bildbühne, Rotfiler, Platine f. Durst Vergrößerungsgerät M 301/302 | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Negativbühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 14735 | Negativ-Bild-Bühne für OMEGA CHROMEGA D | Kleinbild-Metallmasken Bildbühne Magnifax 4 24x36 mm 35mm Metal masks Magnifax 4 | Durst SIDIA 5x5 Einlagemaske für gerahmte 35mm Dias 118132 für SIVONEG Bildbühne | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Negativbühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 14735 | Rollei Buchbildbühne für Dias. #X-31-19 | Durst Nevoneg Bildbühne für Durst Vergrößerungsgerät M 302 | Durst M601 Sivoneg einstellbar Negativ Bildbühne Negative Carrier bis to 6x6 | Rollei Schablone für Buchbildbühne (18x24, Loch oben). #X-31-21 | Durst Urnov Bildbühne-Film Repro Cassette / Holder bis 6x9cm für Durst M601 | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Diabühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 17030 | Rollei Schablone für Buchbildbühne (126). #X-31-20 | Negativ Bildbühne für OMEGA CHROMEGA D | Kaiser 5X5cm Buchbildbühne Negativbühne VCP 6000 für Negative oder glaslos Dias |
| € 17,90 | € 49,00 | € 35,00 | € 29,00 | € 25,00 | € 45,00 | € 59,99 | € 18,90 | € 49,99 | € 9,99 | € 59,01 | € 28,00 | € 9,99 | € 35,00 | € 49,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |
Der eigentliche Vorteil solcher Vergrößerungsbildbühnen ist jedoch, dass man bei ihnen ein Sandwich aus Klarglas und Antinewton-Glas einsetzen kann:
Antinewtonglas verwenden
Jetzt bin ich bald dort angekommen, wie ich mir die für meine Vorstellung ideale Konstruktion für das Abfotografieren von Diafilmen und Negativen vorstelle:
- Eine gute Leuchtplatte (Kaiser Slimlite plano) sorgt für das korrekte (neutrale) Licht.
- Eine gute Buchbildbühne sorgt für eine exakte Positionierung sowie für das plan Halten des Filmes (Kaiser FilmCopy Vario).
- Durch ein Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule und Kugelkopf (dazu komme ich gleich) positioniere ich die Kamera genau planparallel zum Film – und zwar mit dem Spiegeltrick.
Allerdings nutze ich nicht die glaslosen Filmmasken für die Buchbildbühne. Ich schwöre bereits beim Scannen auf ein „Sandwich“ aus Klarglas und Antinewton-Glas (AN-Glas). Nur damit kann ich wirklich sicher sein, dass das Negativ bzw. der Diafilm absolut plan und parallel gegenüber dem Objektiv meiner Digitalkamera positioniert ist. Sie mögen meinen, dass zwei zusätzliche Glasflächen die Bildqualität mindern können. Nach einem Test weiß ich, dass dies bei der Verwendung von Glas, welches tatsächlich für fotografische Zwecke entwickelt worden ist, nicht der Fall ist. Also plättet man das Negativ einfach zwischen zwei solcher Glasflächen. Doch Halt! Dann passiert oft dies:

Bei der Verwendung von Klarglas ↔ Film ↔ Klarglas können sogenannte Newton-Ringe entstehen.
Aus diesem Grund gab es für Vergrößerer das Antinewton-Glas (AN-Glas), welches aus einer geätzten Oberfläche besteht. Gab ist kursiv gesetzt. Denn Kaiser Fototechnik bietet das AN-Glas weiterhin an sowie natürlich auch die Klarglas-Einlagen. Ansonsten sind mir leider keine Anbieter mehr hierfür bekannt. Als Alternative kann man Bilderrahmen-Glas mit Antireflexoberfläche verwenden. Das Glas (An-Glas & Klarglas) wird nun einfach in die Kaiser Buchbildbühne gesetzt:
Klarglas ↔ Film ↔ AN-Glas.
Danach klappt man die Bildbühne zu und erhält eine kaum zu übertreffende Planlage (= die maximal mögliche Auflösung ist digitalisierbar). Die aufwendigere Alternative hierzu ist: die Nassmontage. Dank AN-Glas auf der glatten Filmträgerseite werden hierbei keine der berüchtigten Newtonsche Ringe entstehen. Man kann hierbei auch auf das AN-Glas verzichten und anstelle diesem eine für den Film passende Glaslosmaske einlegen: Klarglas ↔ Film ↔ Plastikmaske. Hierbei muss sich der Film jedoch unbedingt mit der matten Schichtseite nach oben wölben, damit er durch das Klarglas platt– bzw. unter Spannung gedrückt wird. Die meisten Filme wölben sich jedoch in Richtung (glatter) Trägerseite (dann braucht man das AN-Glas). Ich bin bisher mit der Kombination Klarglas / AN-Glas zu hervorragenden Ergebnissen gekommen mit klar dargestelltem Filmkorn bis in die Bildecken meiner abfotografierten Negative.
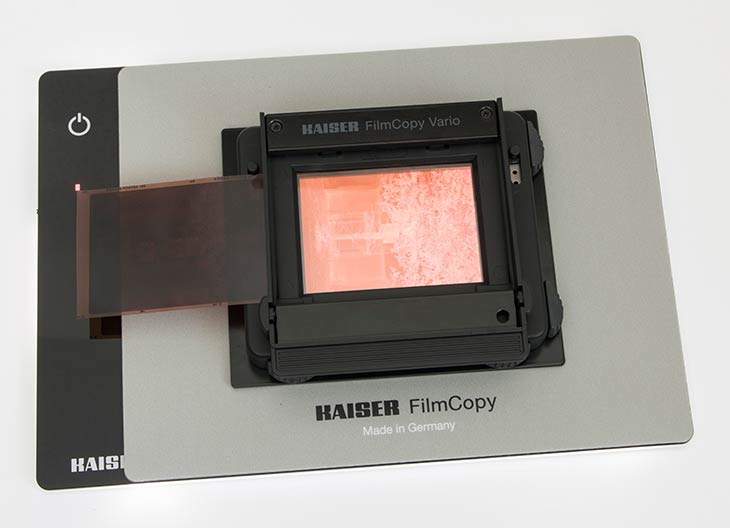
Hinweis: Manche Filme (wie der Kodak Portra im Mittelformat) sind selbst auf der Trägerseite ziemlich glatt (bzw. nicht rau genug). Selbst auf dieser Seite kann es zu den Newtonschen Ringen beim Anpressen kommen. Abhilfe: Man legt einen schmalen bzw. dünnen Papierstreifen mit in die Bildbühne, dass diese nicht ganz zuklappt bzw. dass ein ganz dünner Spalt bestehen bleibt. Zudem spielt hierbei offenbar auch die Luftfeuchtigkeit selbst eine Rolle. Früher gab es im Handel sogar spezielles Spray (Tetenal Anti-Newton Spray) gegen solche Bildfehler bzw. für die Glasbühnen.
Solche großen Mittelformat-Negative fotografiere ich grundsätzlich nur im Glas-Sandwich bzw. in der Bildbühne ab. Ansonsten werden sie durchhängen. Sie werden dann also niemals richtig scharf fotografiert werden können. Bei 35mm Kleinbildstreifen ist dies weniger kritisch. Und: Sie können natürlich auf die Buchbildbühne verzichten und einfach nur die beiden Gläser auf das Leuchtpad legen bzw. den Film dazwischen positionieren. Besser geht dies natürlich mit einer stabilen Bildbühne, in welcher die Gläser fest eingesetzt sind.
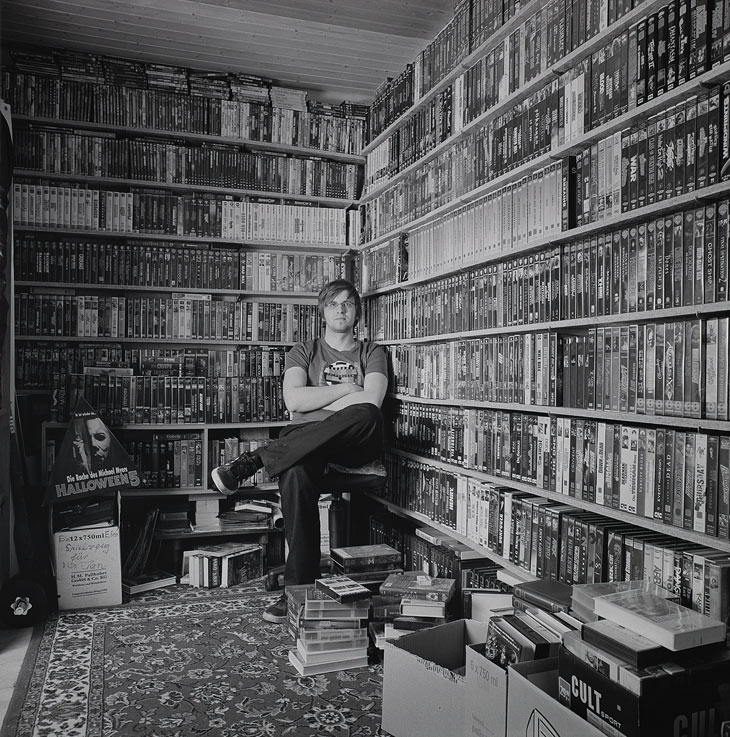
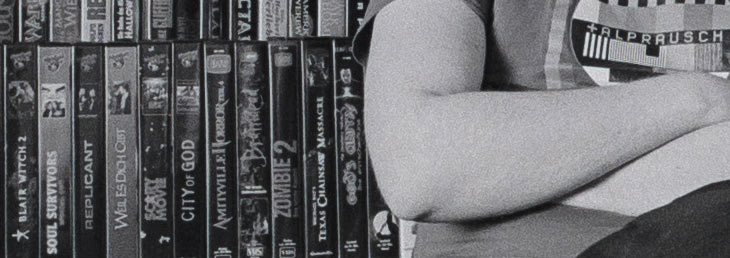
Detail dieses abfotografierten Filmes / Motivs: Mein Modell war so vorhersehend, sich extra noch ein Testbild anzuziehen, mittels welchem man die klare Linientrennung bzw. die Auflösung und Schärfe dieser Digitalisierung via Digitalkamera gut repräsentieren kann (Film: Kodak TriX, ISO 400, also relativ grob auflösend). Mittels „Sitchen“ käme man noch näher in den Film hinein.
Ein völlig scharf digitalisiertes 6×6 S/W-Negativ: Jegliche Schrift auf den Kassetten ist klar lesbar. Die Leuchtplatte darunter sorgte für eine völlig gleichmäßige und helle Ausleuchtung. Für alle, die hier sicher gehen möchten, empfiehlt sich zur stabilen (und planparallelen) Montage des Filmes eine solide Buchbildbühne:
Das Kaiser Filmcopy Kit besteht aus der Slimlite plano Leuchtplatte + der Buchbildbühne inkl. Einlagen für das Kleinbild. Es wurde speziell für das Abfotografieren von analogen Vorlagen (Dias & Negative) entwickelt. Optional erhältlich sind diverse Masken und Glaseinlagen für verschiedene Filmformate.
 € 268,15
€ 268,15 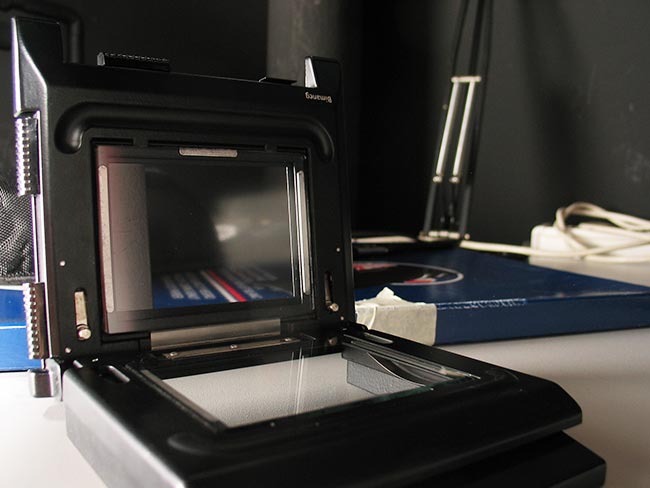
Eine Bildbühne von Durst (damaliger Marktführer) mit AN-Glas oben und Klarglas unten (wechselbar).
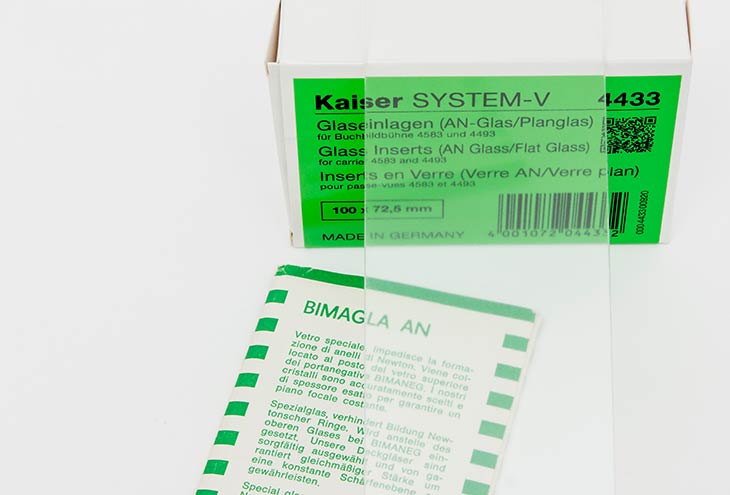
Antinewton-Glas: Schaut man hindurch, erscheint das Gesehene leicht milchig. Dies liegt an der leicht geätzten Oberfläche. Kaiser Fototechnik bietet das AN-Glas heute noch an. Die Firma Durst vertrieb es vor einigen Jahren noch als „Bimagla AN“ in diversen Größen. Auch von Meopta gab es einzelne Gläser bzw. Sets. So etwas lässt sich via Ebay noch gebraucht kaufen (je größer desto teurer). Die Firma Kienzle Phototechnik biete offenbar ebenfalls Antinewton-Glas an (laut einem Kommentar auf dieser Seite). AN-Glas ist häufig nur auf einer Seite geätzt: Halten Sie das Glas so vor sich, dass dessen Ende direkt auf Ihre Nasenspitze zeigt. Sie sehen schräg auf eine der beiden Oberflächen. Jene, bei welcher Spiegelungen der Umgebung milchig erscheinen, ist die geätzte AN-Oberfläche. Diese muss dann auf der glatten Seite des Negativs positioniert werden. Ich markiere mir dies mit einem Edding.
| | | | | | | |
| DURST LABORATOR 1000 OTOGLAS AN für Negativhalter OTONEG 2 | Durst AN Anti Newton Glas 185mmX130mm 2,8mm für Negativbühne 15070 | Durst Sivogla AN Anti Newton Glas für M605 M601 M670 M70 M707etc. 17026 | REVUE DIARÄHMCHEN 24x36 100 Stück Spezial-Antinewton-Glas NEU OVP ungeöffnet | LEITZ FOCOMAT Ic, Focotar-2 und Antinewtonglas = tadellose Komplettausstattung | Durst AN Anti Newton Glas 185mmX130mm 2,8mm für Negativbühne 15060 | Durst Graglas 138 AN Anti Newton Glas 180mmX145mm 2,7mm für Negativbühne 16094 |
| € 45,00 | € 99,00 | € 59,90 | € 10,00 | € 800,00 | € 89,00 | € 99,00 |
 |  |  |  |  |  |  |
| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

Tipp: Sie können den Aufbau auch simpler vornehmen – Denn es hat sich heraus gestellt, dass günstiges entspiegeltes Bilderrahmenglas eine gute Alternative zu AN-Glas ist.

Jüngst hatte ich mit dieser Methode Schmalfilm (16mm-Film) digitalisiert – Nein, nicht die ganzen Streifen sondern nur einige einzelne Bilder. Hier nutzte ich ebenfalls das rauhe Glas unten und darüber das klare Glas für eine gute Planlage. Ich nutzte hier keine Buchbildbühne, weil ich ca. 12 Einzelbilder eines Filmstückchens gleichzeitig (zusammen) abfotografierte.
Schichtseite oder Trägerseite: Was zeigt zur Kamera?
Ein fotografischer Film hat (meistens) zwei Seiten: Die glatte Trägerseite und die (meist) raue Schichtseite. Letztere interessiert uns beim Abfotografieren, denn dort sind die Bildinformationen gespeichert. Kurz: Für kleinere Ausdrucke bzw. für das Zeigen von abfotografierten analogen Filmen übers Internet ist es egal, wie herum der Film beim Digitalisieren gedreht war. Den Unterschied sieht man erst bei einer sehr großen Vergrößerung:
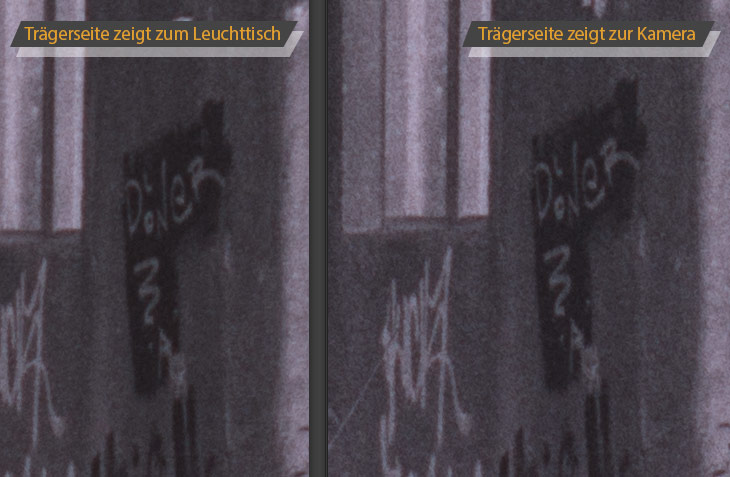
Bei dieser Abbildung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen: Die rechte Seite zeigt die Aufnahme, bei welcher die Schichtseite zur Kamera zeigt, die linke (leicht unschärfere) zeigt das Detail, während die Schichtseite zum Leuchttisch zeigt.

Der Bildausschnitt (Kleinbild) stammt von dieser Bilddatei – Sie kommt so direkt aus der Kamera bzw. wurde nicht weiter bearbeitet.
Richtig wäre, dass beim Abfotografieren von Film die raue Schichtseite hin zur Kamera zeigt. Die Bildnummern am Rand müssten also beim Betrachten von oben spiegelverkehrt erscheinen. Denn wenn es anders herum wäre, fotografiert man ja noch durch den Filmträger hindurch und (falls benutzt) durch das geätzte AN-Glas darüber! Aus dem Fotolabor stammt der Spruch: Schicht auf Schicht. Das bedeutet, dass die Negativ-Schicht vis-à-vis zur Schicht des Kopiermediums zeigen muss (was in diesem Fall der Sensor der Digitalkamera ist). Der Unterschied ist bei meinem Vergleich marginal. Nur bei voller Vergrößerung wird das fotografische Korn bei der richtigen Positionierung etwas besser / schärfer deutlich. Ich bin etwas pedantisch. Ich möchte möglichst das Optimum aus meinen Filmen durch das Abfotografieren heraus holen und daher lege ich die Negative / Dias so in den Filmhalter ein, dass deren Schichtseite nach oben hin zur Kamera zeigt und nicht nach unten zur Leuchtplatte. Das selbe Prinzip gilt übrigens auch fürs Scannen und fürs Fotolabor (dort in der Regel nur anders herum). Der sichtbare Qualitätsgewinn ist jedoch marginal.
Das richtige Objektiv: Nimm ein Makro-Objektiv
Wenn der Film nicht richtig positioniert worden ist, nutzt das beste Objektiv nichts. Daher wurde dem vorherigen Punkt recht viel Zeit eingeräumt. Zum Aufnahmeobjektiv mache ich es zunächst kurz: Wenn Sie das Optimum beim Abfotografieren Ihrer Dias oder Negative erreichen wollen, kommen Sie wohl nicht um ein echtes Makro-Objektiv herum.

Bei diesem direkten Vergleich zwischen einer guten Festbrennweite und einem „echten“ Makroobjektiv sehen Sie schon, worauf ich hinaus möchte: Im Bildzentrum (hier die Gans) bilden beide Objektive tatsächlich gleich stark ab – bis aufs fotografische Korn. Aber an den Ecken… Die Außenbereiche des Bildes bilden hier die Krux. Zudem treten beim „normalen“ Objektiv chromatische Aberrationen auf (die Farbsäume an den Kanten) sowie häufig Verzerrungen. Für einen 13 x 18 cm Druck (oder eine kleine Web-Ansicht) spielt dies kaum eine Rolle. Möchte man jedoch hochauflösende Digitalisierungen für größere Drucke, kommt man um ein hierfür geeignetes Objektiv kaum herum: Es bildet auch an den Bildkanten das fotografische Korn ab.
Denn Makroobjektive wurden genau dafür konstruiert (und „berechnet“) für das, was ich hier mache: Eine winzige, briefmarkengroße Vorlage formatfüllend (und ggf. darüber hinaus) ohne Schärfeverlust und ohne Verzerrungen an den Bildrändern abzufotografieren. So etwas tut man als normaler Fotofreund eher weniger. Ich habe hierzu mehrere meiner Objektive verglichen:

Grundsätzlich setze ich hierbei auf Festbrennweiten und nicht auf Zooms. Festbrennweiten besitzen – davon gehe ich zumindest aus – per se schon einmal bessere Abbildungseigenschaften als Zoomobjektive. Verglichen habe ich meine „analogen“ Nikon Festbrennweiten, die ohne Adapter auch an meine Nikon Digitalkamera passen:
- Ai Micro Nikkor 55mm 1:3.5 (ohne Zwischenring)
- Ai Nikkor 50mm 1:1.8 (mit Zwischenring)
- Nikkor 35mm 1:2.8 (mit Zwischenring)
- Ai Nikkor 28mm 1:3.5 (mit Zwischenring)
- PC Nikkor Shift 35mm 1:2.8 (mit Zwischenring)
Die (Warn-) Farben deuten bereits darauf hin, welche Objektive hier überhaupt (nicht) geeignet sind.
Absolut Analog ist ein modernes Fachbuch, welches den Leser an die Hand nimmt und ihn durch den kompletten "Workflow" der analogen Fotografie begleitet: Von der korrekten Aufnahme über die Negativentwicklung bis hin zum individuellen Scan und Ausdruck. Das Thema Positivlabor wird hier jedoch nur angerissen (bezieht sich auf die 2. Auflage). Dafür wird der digitalen Weiterverarbeitung ("hybrid") mehr Raum gewidmet. Auf Amazon kann man auch in dieses Buch einen Blick werfen.
Die richtige Blende
Die richtige Blende beträgt bei allen meiner getesteten Objektive Blende 8 oder 11. Blendet man zu stark ab, kommt es zur Beugungsunschärfe und die Ergebisse werden in der 100%-Ansicht deutlich unschärfer. Bei keinem meiner Objektive kann ich bei der Makrofotografie auf Blende 16 oder noch höher abblenden! Es entstehen dann deutlich unscharfe Bilder (in der 100%-Ansicht).
Für fast alle meiner Festbrennweiten (außer für das Makro „Nikkor Micro“) musste ich für meinen Test zusätzlich noch einen Zwischenring nutzen (mein Makroobjektiv braucht einen solchen, kurzen dennoch, wenn formatfüllend abfotografiert werden soll):
Zwischenring für normale Objektive nutzen

Solch ein Zwischenring wird zwischen Kamera und Objektiv gesetzt. Erst hierdurch kann man mit den meisten „normalen“ Objektiven genügend nah an die Vorlage (also an Negativ / Dia im Filmhalter) heran gehen können. Ohne Zwischenring wird man bei diesem geringen Abstand nicht mehr korrekt fokussieren können. Auch für mein Makro-Objektiv benötige ich einen kurzen Zwischenring, wenn ich Kleinbildnegative formatfüllend abbilden möchte. Für Mittelformat-Vorlagen benötige ich hingegen keinen.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Zwischenringen: Einmal ganz simple und günstige, wie ich sie verwende: Diese Verlängern lediglich den Abstand des Objektives zum Sensor. Und dann gibt es noch teurere „Auto-Zwischenringe“: Diese übertragen zusätzlich die Mechanik der Springblende. Will sagen: Bei meinen musste ich die Blende am Objektiv zum Fokussieren manuell öffnen und zum Fotografieren wieder auf den gewünschten Wert schließen.
Bei den Auto-Zwischenringen erübrigt sich dies: Man kann hier die Blende weiterhin an der Kamera einstellen. Daher eignen sich die ganz einfachen Zwischenringe nicht für moderne Objektive, bei denen die Blende nur durch die Kamera selbst definierbar ist. Aber ich nutzte für meinen Vergleich nur alte Nikkor-Objektive aus den 1980ern, bei denen man die Blende noch am Objektiv einstellen kann.
Noch etwas: Zum korrekten manuellen Fokussieren empfiehlt sich die LiveView-Funktion der Kamera. Sie ist genauer als das scharf stellen über den Sucher! Bei meiner Nikon DSLR muss ich hierbei jedoch immer die Blende des Objektivs auf den geringsten Wert stellen. Da ich dies also ohnehin tun muss, benötige ich hier keinen Auto-Zwischenring, der die Springblende unterstützt: Sie funktioniert bei LiveView eh nicht (zumindest bei meiner Kamera).
Dies sind Automatik-Zwischenringe: Die Springblende und Automatikfunktionen werden weiterhin übertragen. Somit eignen sie sich auch für moderne Objektive.
Außerdem schlucken Zwischenringe etwas Licht. Da ich hier jedoch mit einer Digitalkamera fotografiere, sehe ich dies auf dem Histogramm des Displays und kann entsprechend manuell mit der Belichtungszeit entgegen steuern.
Übersicht Test verschiedener Objektive
Fotografiert habe ich mit meiner Nikon D7100. Das ist eine Crop-Digitalkamera (also kein Vollformat). Da jedoch bereits im Crop-Format bei allen getesteten „normalen“ Objektiven Störungen an den Rändern auftauchen, sollte dies im Vollformat noch ausgeprägter sein, da hier noch mehr vom kritischen Rand des Bildkreises des Objektives genutzt wird. Fotografiert wurde wieder folgendes 35mm Kleinbild-Negativ:

Das Kleinbildnegativ wurde mit einer Buchbildbühne und mit Klarglas ↔ AN-Glas von der Leuchtplatte abfotografiert. Ich bin hier noch nicht einmal mit der Crop-Kamera formatfüllend nah genug heran gegangen, trotzdem sind hier Unterschiede erkennbar. Markiert ist der unkritische Bereich (Bildzentrum) sowie ein bereits kritischer Bereich (Negativecke). Und so schaut die Bildmitte beim Abfotografieren mit den unterschiedlichen Objektiven in der vollen Auflösung aus:
Öffnen Sie diese Grafik via Rechtsklick → im neuen Tab öffnen. Ganz oben steht jeweils ein Kürzel für das jeweilige Objektiv und die hierfür beste Blende. Die Unterschiede sind im Bildzentrum marginal. Alle Objektive haben hier an dieser Bildstelle einen guten Dienst geleistet! Die 50 mm Festbrennweite zeichnet hier sogar einen Tick besser als das Makro-Objektiv. Aber das will noch nichts heißen. Denn jetzt schaue ich mir die kritischen Bildecken an:
Hier fallen die Unterschiede schon deutlich größer aus. Öffnen Sie auch diese Grafik via neuem Tab in der 100%-Ansicht. Nur beim Makro-Objektiv (Nikkor Micro 55mm 1:3.5) ist das Filmkorn an den Bildecken noch dargestellt. Bei allen anderen Objektiven ist dieser Bereich bereits verwaschen abgebildet. Am schlechtesten schneidet hier das 28 mm Weitwinkel ab. Die 50mm Festbrennweite zeichnet noch akzeptabel. Ich dachte, mein Shift-Objektiv wird die Bildecken im Makro-Bereich noch gut darstellen, weil es so einen großen Bildkreis besitzt. Dem ist aber nicht so. Diese Objektive sind für solche Vergrößerungsmaßstäbe einfach nicht geschaffen / berechnet..
Einzelne Testreihen hatte ich je Objektiv natürlich auch vorgenommen, um je die optimale Blende ermitteln zu können. Diese wurde dann bei den Vergleichen je eingestellt.

Ein älteres Makro-Objektiv (Ai Micro Nikkor 55mm 1:3.5). Um Kleinbildnegative vollformatig zu digitalisieren, benötigt es noch einen kurzen Zwischenring.
Zum Abfotografieren von Dias und Negativen mit der Digitalkamera sollte man an dieser also ein Makro-Objektiv nutzen. An meine Nikon DSLR passt das bekannte „Micro Nikkor 55mm 1:3.5“. Es hat sich im Test als sehr brauchbar erweisen und besitzt ohnehin einen guten Ruf. Gebraucht bekommt man es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels für ca. 120 Euro. Es gibt freilich auch viele andere gute Makroobjektive – auch mit Autofokus und dergleichen. Natürlich eignet sich solch ein Objektiv auch für alle zivilen Fotomotive sehr gut! Ich nutze meines auch als ganz normale Standard-Festbrennweite, auch für Motive bei Unendlich-Stellung des Fokussierrings.
Falls Sie eine Nikon-DSLR besitzen und ein altes „analoges“ Objektiv auf dieser nutzen möchten, informieren Sie sich aber vorher bitte, ob diese Objektive „Ai“ oder „non Ai“ an Ihre Kamera passen. Ken Rockwell hat hierzu eine Übersichtstabelle erstellt. Die meisten besseren Nikon DSLR-Kameras sind hierfür tauglich. Was dieses „Ai“ bedeutet, können Sie hier nachlesen → alte Objektive auf digitaler Nikon nutzen.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nippon Kogaku Japan Micro-Nikkor Auto f3.5 55mm Staub | Nikon Micro-NIKKOR-P Auto 3,5/55 NON AI MICRO Lens 55mm 3.5 | Nikon Micro-Nikkor 1:2.8/55 mm Macro Objektiv Ai-S Makroobjektiv lens | Nikon AiS Micro-Nikkor 55mm 1:2.8 Objektiv | Nikon Ai-s Micro Nikkor 55mm F/2.8 Objektiv Mit / Soft Case [Exzellent Ab Japan | EX Nikon Micro NIKKOR P Auto Non Ai 55mm F/3.5 w/ Filter From JAPAN | Nikon F Micro-Nikkor 1:3.5 55mm Objektiv | Nikon micro-Nikkor 55 mm 1:3.5 SLR Objektiv | NIKON MF 55mm f/3,5 MICRO-Nikkor mit zubehör - SNr: 1105875 | Nikon AF Micro Nikkor 55mm 1:2.8 für Nikon AF - 62282 | Nikon Micro- Nikkor 55mm f/3,5, AI, MF | Nikon Ai-S Micro-Nikkor 55mm 1:2.8 Objektiv | Nikon Micro-Nikkor 2,8/55mm #201434 AIS -LESEN- | Nikon AF Micro Nikkor 55mm F2.8 " Bitte LESEN " | Nahe Mint Nikon Ai-s Micro Nikkor 55mm F/2.8 Macro Mf Objektiv Aus Japan |
| € 40,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 75,00 | € 84,60 | € 69,96 | € 59,85 | € 95,00 | € 89,00 | € 99,00 | € 95,00 | € 81,00 | € 99,00 | € 99,00 | € 84,88 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |
Möchte ich mit dem Micro Nikkor 55mm mit meiner Crop-Digitalkamera ein Kleinbildnegativ abfotografieren, kann ich dieses nicht formatfüllend abbilden. Hierzu fehlt noch ein kurzer Zwischenring (für Vollformat ein noch höherer, z. B. Nikon PK-13) und damit sieht das Ergebnis dann so aus:
ein abfotografiertes Kleinbild-Negativ in voller Auflösung
Auch dieses Bild bitte wieder via Rechtsklick im neuen Fenster / Tab öffnen. Die Maße betragen 6000 x 4000 Pixel, was eben die Auflösung der Digitalkamera darstellt. Abfotografiert wurde dieses Negativ bei Blende 8. Das fotografische Korn ist an jeder Stelle deutlich abgebildet – auch an den Ecken!. Das Bild kam so direkt aus der Kamera bzw. aus dem RAW-Konverter. Geschärft wurde nur mit der Voreinstellung (Wert 25). Eine Auflösung von 24 Megapixel ist für solch ein Kleinbildnegativ eigentlich zu viel des Guten: Bereits bei der Hälfte (12 Megapixel) sollten alle Bildinformationen sauber digitalisiert werden können.
Übrigens: Makroobjektive gibt es natürlich mit unterschiedlichen Brennweiten. Meines hat eine von 55 mm, was vielleicht recht kurz erscheint. Bei einer längeren Brennweite muss das Objektiv dann weiter vom Leuchttisch weg positioniert werden. Ich möchte Dias und Negative aber im Sitzen abfotografieren:

Durch die relativ kurze Brennweite bzw. durch den kurzen Abstand zur Leuchtplatte sitzt die Kamera nicht allzu hoch, so dass ich sie bequem im Sitzen bedienen kann und sodass auch ein kleineres Stativ völlig ausreichend ist. Dank Fernauslöser, Klappdisplay oder Tethering würde es allerdings auch nicht stören, wenn die Kamera höher positioniert ist.
Abfotografieren mit einem Vergrößerungsobjektiv
Oftmals wird anstelle eines passenden Makroobjektives ein Vergrößerungsobjektiv aus dem Fotolaborbereich genutzt:

Die Argumentation: Diese Objektive sind dafür berechnet worden, eine kleine Vorlage (das Negativ) auf eine viel größere zu projizieren (das Fotopapier). Also müsste dieses auch für das Abfotografieren geeignet sein (keine Verzerrungen an den Rändern, keine Unschärfe dort). Um solch ein Objektiv an die Digitalkamera zu adaptieren, benötigt man ein ordentliches und passendes Balgengerät. Vorne muss noch ein M39-Adapter angebracht werden, in welchen sich das Vergrößerungsobjektiv schrauben lässt.
Ohne Balgengerät kann man nicht scharf stellen, da solche Objektive keine eigene Fokussier-Schnecke besitzen. Zwischenringe bringen hier also nichts. Es gibt als Alternative zum Balgengerät jedoch auch sogenannte „Makroschnecken“, auch als „Helicoid“ bezeichnet. Dies sind „zoombare“ Zwischenringe. Nutzt man ein Balgengerät, sollte man sicherlich ein Vergrößerungsobjektiv mit längerer Brewnnweite (80 mm) nutzen. Denn ggf. lässt es sich nicht genügend kurz zusammen stauchen.
Mittels solch einem Balgengerät kann das Objektiv viel weiter von der Kamera weg positioniert werden, wodurch ein sehr nahes Herangehen an das Motiv möglich ist. Der Vorteil zu Zwischenringen: Dies lässt sich variabel und genau einstellen.
Ein anderer Fotofreund schreibt auf seiner ausführlichen Seite:
Vergrößerungsobjektive, mit ihrem idealen Maßstab von 1:10 bis 1:40, können sich an die gewünschte Qualität lediglich annähern.
Ein gutes Makro-Objektiv sei also besser für das Digitalisieren von Film geeignet als ein Vergrößerungsobjektiv. Die Ränder würden bei letzterem nicht scharf genug abgebildet werden. Zudem erspart man sich den Aufwand mit dem Balgengerät oder der (teureren) Makroschnecke.
Mein eigener Test ergab ebenfalls schwächere Abbildungseigenschaften als mein Micro Nikkor. Da ich jedoch eine recht improvisierte Halterung hierfür nutzte (fehleranfällig) stelle ich davon keine Bilder ein und kann bei diesem Thema nur beim Konjunktiv bleiben.
Optik aus einem Scanner nutzen
Dieser Tipp ist nur etwas für Bastler: Kommt man günstig zu einem defekten Filmscanner, so steckt in so manchem dieser Geräte offenbar ein äußerst interessantes Objektiv, welches nur für den Nahbereich bzw. nur für die Makrofotografie berechnet wurde. Auf dieser Seite (englisch) stellt ein Enthusiast mehrere dieser Objektive vor. Ich selbst habe damit jedoch keine Erfahrung. Und wer hat schon einen Nikon Coolscan zum Ausschlachten stehen?
Weitere Tipps für eine hohe Bildqualität
Die vier wichtigsten Punkte
- Lichtart
- Filmhalter
- Positionierung der Kamera
- Objektive
habe ich nun besprochen bzw. hinter mir. Jetzt folgen noch einige weitere Tipps und Hinweise, welche für eine möglichst hohe Bildqualität berücksichtigt werden können:
Gute Digitalkamera
Zum Thema Digitalkamera verliere ich in diesem Artikel nur wenige Worte. Sie sollte natürlich gewisse „Standards“ beherrschen. Die Freude wird etwas getrübt, wenn der Sucher das Motiv etwas beschneidet oder wenn manuelle Einstellungen hinter Menüs versteckt sind, wenn haptische Knöpfe fehlen. Ich nutze gerne semiprofessionelle Kameras: Die großen Hersteller bieten oft grob drei Produktgruppen an: Die „goldene Mitte“ ist für mich preislich noch erschwinglich und stellt für solch technische Fotografie ein gutes Werkzeug dar. Ich hatte mir vor einiger Zeit eine gebrauchte Nikon D7100 gekauft, mit der alle hier erklärten Aufgaben sehr gut zu meistern sind und dessen Auflösung (4000 x 6000 Pixel) ausreichend hoch ist. Der Vorteil bei solch einer Kamera mit kleinem Sensor („Crop-Sensor“): Der Bildkreis meines verwendeten „analogen“ Objektives wird nicht ganz ausgenutzt (wie bei einer Vollformatkamera). Daher kann hier die Zeichnung an den Bildecken sogar etwas besser sein. Doch dies dürfte bei einem ordentlichen Makroobjektiv marginal sein.
Natürlich sollte sich das Gerät im manuellen Modus „B“ betreiben lassen.
Weitere, für das Abfotografieren sinnvolle Funktionen sind die Spiegelvorauslösung und das Einblenden einer Fokus-Anzeige für manuelles Fokussieren nach Auge. Manch einer kommt als Brillenträger schlecht mit kleinen Suchern klar. Hierfür wäre dann die Möglichkeit „LiveView“ eine gute Alternative. Mittlerweile empfehle ich die LiveView-Funktion unbedingt für Makro-Aufnahmen wie den hier besprochenen. Denn ein Fokussieren über den Umlenkspiegel einer Spiegelreflexkamera kann fehleranfällig sein!
Zudem wäre es schön, wenn man das Display der Kamera klappen kann, besonders wenn sie vertikal auf einem Reprostativ / Stativ positioniert ist.
Manueller Modus 16 Bit RAW
Für die höchste Bildqualität und für die beste Voraussetzung für die nachträgliche Bildbearbeitung empfehle ich, die Digitalkamera im RAW-Modus zu nutzen (keine JPG-Bilder) und natürlich im manuellen Modus (alle Parameter werden fix eingestellt). Die RAW-Bilder sollten dann auch im 16-Bit-Modus in die Bildbearbeitung importiert werden. Hierbei verringert man eventuelles „Clipping“, Rauschen, Schärfe-Artefakte und andere Bildfehler bei starker Bearbeitung. Beim Umwandeln von Negativen in der Bildbearbeitung in Positive habe ich festgestellt, dass dies (die automatische Farbausfilterung) offenbar viel besser mit RAW-Dateien möglich ist.
Der ISO-Wert
Natürlich sollte man für das Optimum einen möglichst geringen ISO-Wert an der Kamera einstellen (meist ISO 100).
Die Belichtungszeit
Bei ISO 100 und bei einer Blende von 8 komme ich bei meiner LED-Leuchtplatte häufig auf eine Belichtungszeit von 1/4 Sekunde. Daran kann man sich ungefähr orientieren (sie hängt aber auch von der Dichte des Filmes ab). Natürlich ist auch deswegen eine stabile Kamerahalterung nötig. Zur Beurteilung der richtigen Belichtungszeit ist das Histogramm der Kamera sehr wichtig! Es darf hier nichts beschnitten sein.
Allerdings belichte ich im RAW-Modus eher nach rechts:
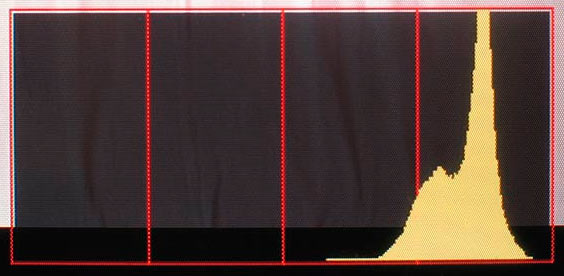
Hinweis: Dies bitte nur machen, wenn man im RAW-Format fotografiert. Nach rechts belichten bedeutet: Ich belichte so lange, dass die Kurve bei Ansicht auf dem Histogramm der Kamera möglichst rechts steht, ohne dass sie jedoch beschnitten wird. Anders ausgedrückt: Die Belichtungszeit ist genau so lange, dass die abfotografierte Leuchtplatte (ohne Negativ) gerade so noch ohne Beschnitt im Histogramm (im kopierbaren Bereich) liegt. Der Kontrastumfang meiner Digitalkamera wird in seiner Gänze ausgereizt. Und daher ist die Belichtungszeit bei mir immer gleich lang, da ja die Leuchtplatte immer gleich hell ist (heller wird es nicht). Dies gilt aber nur, wenn man im RAW-Format fotografiert. Denn im RAW-Konverter steuert man dann wieder zurück.
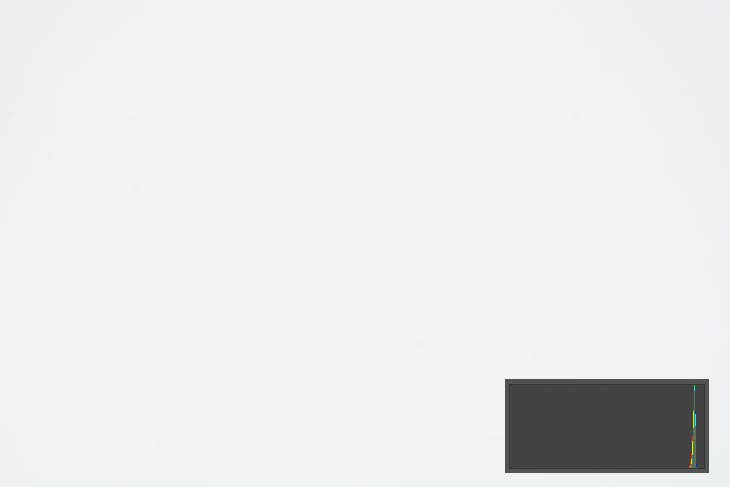
Auf diesem Foto sehen Sie – nichts. Hier wurde einfach die nackte Leuchtplatte abfotografiert. Das Histogramm der Digitalkamera zeigt einen ganz schmalen „Peak“. Dieser befindet sich ganz rechts, befindet sich aber immer noch innerhalb des Histogramms. Damit habe ich die nötige Belichtungszeit für den Aufbau ermittelt. Nur bei deutlich überbelichteten oder überentwickelten Negativen muss die Belichtungszeit ggf. verlängert werden.
Dieses Prinzip nennt man auch „Expose to the right„: Es wird nach rechts belichtet und später im RAW-Konverter nach links entwickelt. Es ist also ganz ähnlich wie die Pull-Entwicklung im Fotolabor. Auf diese Weise erreicht man, dass ein Bildrauschen möglichst gering gehalten werden kann. Bei Negativfilmen erhält man so zudem eine bessere Lichterzeichnung. Außerdem muss man sich nicht mehr um die Belichtungszeit kümmern: Sie bleibt hier beim Abfotografieren stets gleich, da sie auf die längste Zeit eingestellt worden ist, bei der die Lichtquelle noch nicht „überstrahlt“. Dafür ist eine spätere Bildbearbeitung allerdings unumgänglich. Doch diese muss beim Abfotografieren ohnehin immer statt finden. Zur Bildbearbeitung komme ich etwas weiter unten noch zu sprechen.
Mehrmals Belichten
Es ist natürlich auch möglich, das Negativ mehrmals zu belichten, „HDR“ sozusagen. Sinn ergibt dies nur bei äußerst dichten, fehlerhaften Negativen, um eine bessere Zeichnung in den Lichtern zu erhalten. Der sogenannte Dmax, also die Möglichkeit, auch sehr dichte Bildpassagen zu durchleuchten, kann hierbei sehr hoch sein – bei gleichzeitiger korrekter (dünnerer) Schattenzeichnung. Dies trifft häufig auf überentwickelte Filme zu. Eine entsprechende Bildbearbeitung muss hierbei natürlich angewandt werden (zusammen setzen zweier Aufnahmen). Besitzt man Photoshop, kann man die RAW-Daten einer einzigen Aufnahme auch zwei Mal unterschiedlich bearbeiten (einmal auf die Schatten, einmal auf die Lichter) und diese beiden dann als Ebenen mit je einer Ebenenmaske zu einer Bilddatei zusammen setzen. Oftmals erspart dies eine Mehrfachbelichtung.
Überbelichtete Negative
So schaut ein deutlich überbelichtetes Negativ aus:

Gemeint ist das fast schwarze Motiv. Manch Scanner wird hiermit Probleme haben! Nicht jedoch die Digitalkamera: Man belichtet mit ihr einfach deutlich länger und die Bildinformationen tief im Innern des Negativs können digitalisiert werden. Dies sollte man dann aber unbedingt in einem dunklen Raum tun, damit das Umgebungslicht den Kontrast nicht mindert.
Ausrichtung der Kamera mit einem Spiegel prüfen
Der Film ist auf der Leuchtplatte sauber positioniert? Die Kamera ist am Stativ oder an der Reprosäule befestigt und eingerichtet? Dann muss man prüfen, ob beides parallel zueinander ausgerichtet ist!
Hierzu legt man einfach eine kleine Wasserwaage mit zwei Libellen oder eine Dosenlibelle auf das Display der Kamera sowie auf den Leuchttisch / auf die Buchbildbühne und prüft, ob beides korrekt ausgerichtet ist.
Die Sache funktioniert mitunter nicht befriedigend: Zum einen sind diese günstigen Wasserwaagen häufig sehr fehlerhaft in ihrer Funktion (ähnlich wie billige Kompasse). Ich würde mich nicht zu 100% darauf verlassen. Sie springen auch häufig. Zum anderen kann es sein, dass man an seiner Digitalkamera gar keine tatsächlich ebene Fläche auf der Rückseite hat, die parallel zum Objektiv steht (z. B. bei einem klappbaren Display).
Es geht hier besser (und einfacher):

Ein weiterer Vorteil einer Buchbildbühne: Man kann einfach den Spiegel oben auf legen.
Man legt einfach einen kleinen Spiegel auf die Buchbildbühne oder auf die Grundfläche! Dies ist ein weiterer Vorteil gegenüber einem horizontalen Aufbau via beispielsweise Makroschiene, denn dadurch lässt sich durch Sicht durch den Sucher sehr einfach die Kamera (via Kugelkopf) planparallel ausrichten. Und das funktioniert so:
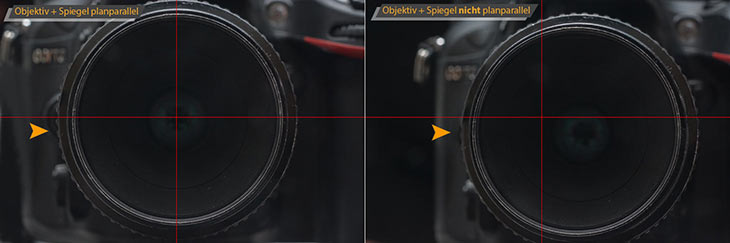
Das Objektiv muss hier genau mittig im Sucher erscheinen. Betrachten Sie bei der rechten Abbildung auch die Unschärfe am linken Objektivrand. Hier ist die Kamera nicht parallel zur Filmbühne bzw. zur Grundfläche (Spiegel) ausgerichtet. Viele Digitalkameras besitzen ein (zuschaltbares) Raster im Sucher. Dieses hilft hier bei der Ausrichtung. Also: Hurtig rüber in den Drogeriemarkt gerannt und sich einen kleinen Rasierspiegel gekauft. Idealerweise ist ein solcher nicht eingefasst bzw. unten absolut plan. Bei meinem Spiegel hatte ich die Plastikfassung entfernt und die Kanten zum Schutz mit Krepp-Klebeband umklebt.
Bezeichnen Sie mich ruhig als Pedant! Ich möchte jedoch das mir mögliche Maximum aus meinen Negativen durch Abfotografieren heraus holen. Daher ist dieser Artikel auch so lang. Die Reprofotografie war noch nie einfach, wenn man eine hohe Qualität anpeilen möchte. Man muss hier auf viele kleine Dinge achten. Es geht noch weiter:
Den Raum abdunkeln
Schauen Sie sich einmal dieses Bild an:

Hier gab es nach dem Abfotografieren des Negativs eine seltsame Erscheinung im Himmel (das hatte ich erst später gesehen. Beim Tethering sieht man’s gleich). Die verzerrte Person ist allerdings so schon auf dem Negativ vorhanden (es wurde mit einer rotierenden Panoramakamera belichtet und später beschnitten).
Dies ist eine Spiegelung, die durch das Raumlicht auftrat. Denn die Belichtungszeiten können beim Abfotografieren schon recht lang ausfallen. Vagabundierendes Raumlicht wird dann ebenfalls von der Kamera erfasst – mitunter in Form von Spiegelungen oder einfach nur als kontrastminderndes Fremdlicht. Insbesondere bei der Verwendung von Glaseinsätzen in der Bildbühne besteht die Gefahr von Spiegelungen.
Ich fotografiere meine Negative und Dias nur in einem abgedunkelten Raum ab: Dieser sollte mindestens so dunkel sein, dass man ein Buch nicht mehr gut lesen kann. Dies gilt aber nur für eher schwächere Leuchtflächen bzw. für längere Belichtungszeiten. Wenn Sie so ein Videolicht direkt vor dem Negativ nutzen oder ein Blitzgerät, werden die Belichtungszeiten kurz sein und damit wird Fremdlicht sozusagen „ausgesperrt“. Deaktivieren Sie Ihr Kunstlicht, sollte bei der hierfür nötigen Belichtungszeit ein nahezu schwarzes Bild aufgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, spielt zu viel Umgebungslicht hinein. Für hohe Ansprüche an Qualität wäre dies ungünstig. Bei manchen Vorrichtungen zum Abfotografieren sind teils Schächte aus schwarzem Karton oder gar Holz aufgestellt oder lange Kompendien vor dem Objektiv vorhanden – nicht ohne Grund.
Einen Fernauslöser verwenden

Die Kamera ist fest auf dem Stativ installiert. Der Fernauslöser liegt auf dem Tisch und ist bequem erreichbar.
Ich drücke bei der Aufnahme nicht direkt auf den Auslöser der Kamera. Ich würde hierbei vielleicht riskieren, dass sich die Kamera dabei bewegt bzw. dass sie sich aus der Lotrechten verstellen wird. Bei langen Belichtungszeiten würde ich eine Vibration durch meinen Finger riskieren. Also nutze ich einen simplen Fernauslöser (Kabelauslöser) und bediene die Kamera damit. Solche Kabelauslöser gibt es für viele neueren Digitalkameras auch günstig von Drittherstellern. Ich nutze solch einen „Noname-Auslöser“ für meine Nikon Kamera ohne Probleme. Er muss ja nicht viel können. Alternativ kann man den Selbstauslöser der Kamera nutzen. Aber dann sollte sie auch fest montiert sein. Bei der Verwendung des Selbstauslösers kann man sicherlich nicht gleichzeitig von einer eventuell vorhandenen Möglichkeit der Spiegelvorauslösung profitieren. Ein Kabelauslöser für die Kamera ist also zu empfehlen.
Mittels solch einem Kabelauslöser (es gibt Modelle für diverse Anschlüsse / Hersteller) lösen Sie Ihre Digitalkamera extern aus bzw. umgehen Verwackelungen, die durch einen direkten Tastendruck am Gerät selbst entstehen können. Bei sanftem Druck kann auch fokussiert werden (Autofokus).
Einen Blaufilter für Farbnegativfilme nutzen
Farbnegativfilme besitzen eine Orange-Maske. In der späteren Bildbearbeitung muss diese im Anschluss an die eigentliche Aufnahme „weggerechnet“ werden. Dies gelingt mir immer recht gut mit den hier vorgestellten Programmen (Weißabgleich auf den Negativrand). Noch besser wäre es, wenn man für solche Color Filme einen Blaufilter vor dem Aufnahmeobjektiv (Makroobjektiv) nutzt. Denn hierdurch gelangt man bereits optisch in den Bereich eines „neutralen“ Bildes: Die RGB-Kanäle des digitalisierten Bildes müssen nicht so stark künstlich entzerrt werden. Ob dies einen qualitativen Vorteil bringt? Ich habe es einmal verglichen:

Dies ist ein solcher Blaufilter, ein sogenannter Konversionsfilter, welcher nur für Korrekturen (und nicht für Effekte) gedacht ist. Ich nutze den Typ „80B“, welcher dem Typ „KB12“ entspricht.
Ich bin durch den Tipp eines freundlichen Lesers meiner Seite hierauf gekommen:
Damit [mit einem Blau-Korrekturfilter] liegen die Histogramme der Farbkanäle von Anfang an näher zusammen und ich gewinne im Grün- und Blaukanal merklich Signalqualität.
Allerdings haben Filter vor dem Objektiv bekannterweise den Nachteil, dass sie durch zwei zusätzliche Glasflächen die Abbildungsqualität des Objektives schmälern könnten. Das müsste man also zunächst einmal vergleichen. Zudem wird das Objektiv durch einen zusätzlichen Korrekturfilter natürlich etwas lichtschwächer. Geeignete Filter hierfür wären die Typen „KB12 und KB15“ – sogenannte Konversionsfilter. Ich besitze einen Blau-Korrekturfilter 80B und hatte einmal verglichen:
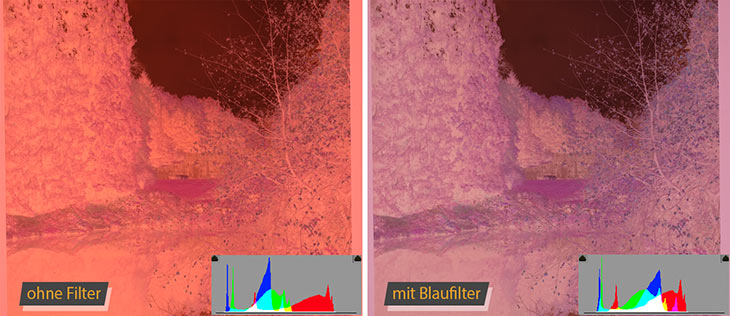
Nachdem die Digitalisierungen je in den RAW-Konverter geladen wurden, sieht man schon einmal deutliche Unterschiede: Die Orangemaske (bzw. deren Farbe) wurde durch den Filter bereits optisch zu einem großen Teil entfernt. Entsprechend „zusammenhängender“ ist auch das Histogramm hier abgebildet.
Übrigens: Der Blaufilter schluckt fast zwei Blenden Licht. Entsprechend musste die Belichtungszeit vervierfacht werden. Ein manueller Weißabgleich musste trotzdem auf den Negativrand vorgenommen werden:

Nach einem manuellen Weißabgleich auf den Filmrand und der Umformung der C41-Negativ-Digitalisierungen in Positive erhielt ich diese beiden Ergebnisse. Die Unterschiede sind also eher marginal (beachte die Bäume links): Die Version mit Filter erscheint etwas natürlicher und differenzierter. Zudem ist die Sättigung der Farben etwas höher. Vor allem hatte ich damit im RAW-Konverter einen viel größeren Spielraum für weitere Anpassungen. Was allgemeiner Kontrast und Bildschärfe anbelangt, sind beide Ergebnisse gleich (der zusätzliche Filter verdirbt hier nichts).
Im Detail betrachtet: Einige Bereiche der ungefilterten Bereiche sind etwas Blau in den Schatten (Bäume links). Macht ja nichts – Dies kann man ja später mit einer ganz leichten Farbkorrektur korrigieren. Allerdings würden hierbei die gelben Bereiche (Blätter rechts) wiederum zu gelb werden. Sie verstehen? Durch den Blaufilter konnte eine leicht bessere Farbtrennung erreicht werden, marginal natürlich.
Für mich heißt dies nun: Ich werde Farbnegative fortan immer mit einem Blaufilter abfotografieren, da ich stets sehr penibel und sauber arbeite. Es bringt mir einen kleinen Vorteil, viel mehr aber auch nicht bei meinem „Workflow“ der Umformung des Negativs im RAW-Konverter.
Etwas weiter unten in diesem Artikel werde ich demonstrieren, wie man den bereits erwähnten manuellen Weißabgleich auf den Filmrand von Farbnegativen vornimmt. Hierbei kann es passieren, dass die Software einen Weißabgleich nicht mehr schafft (weil alles Orange ist). Durch einen Blaufilter bei der Aufnahme wird dieses Problem verhindert und man arbeitet diesbezüglich sozusagen optisch bereits vor: Die elektronische Bildbearbeitung muss weniger leisten. Für Dias oder S/W-Negative spielt dies alles natürlich keine Rolle.
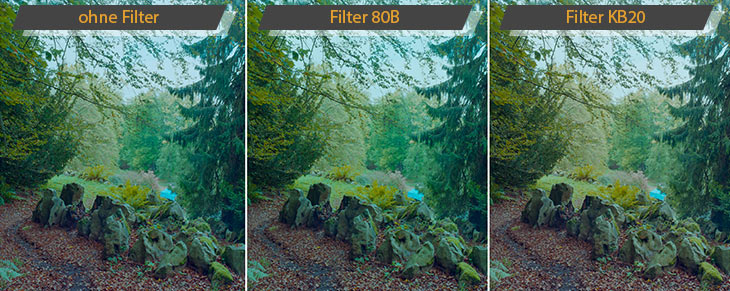
Ich habe seit einiger Zeit einen zweiten Blaufilter – Dieser ist noch blauer: ein B+W KB20. Dies ist kein „harmloser“ Konversationsfilter mehr, sondern ich wollte diesen eigentlich nur für die S/W-Fotografie einsetzen („Luftperspektive“ erzeugen). Meinen Vergleichen nach eignet sich dieser tiefe Blaufiter aber noch besser zum Abfotografieren von Farbnegativen von der Leuchtplatte als ein einfacher Korrekturfilter. Offenbar werden hier die orangenen Bildinformationen (im Motiv Blau) noch besser von der ebenfalls orangenen Farbmaske des C41-Filmes separiert. Bei Zweifel würde ich also eher zum stärkeren Blaufilter raten. Wie jedoch bereits erwähnt: Die Unterschiede sind eher marginal und man kommt hier bereits ohne Farbfilter vor dem Objektiv sehr weit.
LiveView oder Sucher?
Moderne Digitalkameras besitzen eine „Live-View-Funktion“: Das Bild erscheint live auf dem Display oder in der Tethering-Software auf dem Computermonitor. Bei meiner Digitalkamera erscheint im Sucher ein Symbol, wenn korrekt manuell fokussiert ist. Für Brillenträger bzw. für Fotofreunde mit etwas schlechtem Auge kann sie jedoch ein Segen sein. Und: Ein Scharfstellen via LiveView und der darin enthaltenen Lupenfunktion ist präziser als das Fokussieren über den Sucher. Denn bei letzterem wird das Bild noch über einen Spiegel umgelenkt. Dies ist fehleranfällig. Man sollte beides einmal miteinander vergleichen. Bei meiner Kamera ist es tatsächlich so: Der kleine Schärfeindikator-Punkt im Sucher ist nicht so genau wie eine 100%-Ansicht des Live-Bildes auf dem Display. Makro-Aufnahmen stelle ich nunmehr manuell via Display scharf und nutze dort die „elektronische Lupe“. Der Umlenkspiegel der Kamera und das Okular wird hierbei gar nicht erst genutzt. Zu Beachten ist hierbei, dass beim Scharf Stellen die Blende des Objektives geöffnet ist!
Schwenkbares Display
In diesem Zusammenhang wäre auch ein schwenkbares bzw. klappbares Kameradisplay sehr hilfreich – insbesondere wenn die Kamera vertikal an einem Stativ mit drehbarer Mittelsäule montiert ist. Denn hierbei zeigt das Display nach oben. Man sitzt beim Abfotografieren seiner vielen Dias / Filme jedoch davor. Ich muss bei meiner Kamera (kein schwenkbares Display) nach jeder Aufnahme aufstehen und schauen, ob das Histogramm eine korrekte Belichtung anzeigt (erübrigt sich, wenn ich die „Expose to the Right“ Technik nutze bzw. immer gleich lang belichte).
Autofokus oder manueller Fokus?
Da mein altes Micro Nikkor gar keinen Autofokus besitzt, bin ich gezwungen manuell scharf zu stellen (was auch sehr gut geht, siehe vorheriger Punkt). Ich habe mir sagen lassen, dass auch beim Abfotografieren bzw. im Makro-Bereich die Autofokus-Funktion der Kamera sehr gute Dienste leistet.
Filter nutzen?
Ich probiere gerne viel aus und möchte vieles wissen. Es kam mir in den Sinn, einen Polfilter vor dem Makroobjektiv zu nutzen. Das braucht man natürlich nicht – außer vielleicht, wenn stets zu viel Fremdlicht seitlich auf die Bildbühne einfällt. Aber so etwas sollte man grundsätzlich vermeiden. Offenbar wäre es möglich, mittels einem Infrarotfilter eine zusätzliche Aufnahme zur Erfassung von Staub bzw. Störungen anzufertigen. Doch damit kenne ich mich tatsächlich nicht aus bzw. weiß nicht, inwiefern hier die Digitalkamera selbst modifiziert werden müsste. Zum Thema Korrekturfilter bzw. Blaufilter hatte ich ja bereits etwas weiter oben etwas geschrieben.
Die Spiegelvorauslösung verwenden
Außerdem nutze ich die Funktion der Spiegelvorauslösung bei meiner digitalen Spiegelreflexkamera. Diese Funktion besitzen nicht alle Digitalkameras. Mittels dem ersten Druck auf den Fernauslöser wird der Spiegel hochgeklappt. Erst beim zweiten wird ausgelöst. Eine etwaige Vibration durch das Hochklappen des Spiegels bleibt der eigentlichen Belichtung somit erspart. Denn im Makrobereich bewirkt jede minimale Bewegung während der Aufnahme ein Verlust an Schärfe.
Lampe erwärmen
Wenn Sie auch einen Filmscanner besitzen, wissen Sie vielleicht, dass manche Modelle eine kurze „Aufwärmphase“ fordern, bevor gescannt werden kann. Dies dient offenbar dazu, dass die Leuchtmittel erst nach kurzem Betrieb auf ihre „Farbechtheit“ kommen. Ich weiß nicht, inwiefern dies noch bei modernen LED-Lampen relevant ist. Sicherheitshalber lasse ich meinen Leuchttisch erst einmal für einige Minuten an, bevor abfotografiert wird.
Den Negativrand mit fotografieren
Wenn Sie Farbnegative abfotografieren, achten Sie darauf, dass an einer Stelle ein Stückchen vom Negativrand mit fotografiert wird. Denn diesen benötigt man später für den manuellen Weißabgleich in der Bildbearbeitung. Allerdings können Sie dies in einer „Session“ mit dem gleichen Film auch nur einmal tun und diesen Weißabgleich für alle anderen Bilder in der Bildbearbeitung speichern bzw. anwenden. Ich würde aber nicht darauf bauen, dass der selbe Color-Filmtyp innerhalb verschiedener Chargen / Entwicklungen immer den exakt selben Farbton der Orange-Maske aufweist. Ich fotografiere bei jedem Negativ ein Stückchen vom Rand mit und bin so auf der sicheren Seite.
Sauber arbeiten: Staub und Fussel vermeiden
Bei der Reproduktion von analogem Filmmaterial ist es unumgänglich sauber zu arbeiten. Das war im eigenen Fotolabor schon immer so, dies ist beim Scannen sehr sinnvoll und erst recht beim Abfotografieren, da es hier kaum die Möglichkeit gibt, eine zusätzliche Infrarotaufnahme anzufertigen, welche die Basis für eine automatische Retusche bildet. Bei besseren Scannern ist diese Technik als „ICE“, „SRD“ oder „FARE“ integriert. Solch ein Infrarot-Kanal funktioniert jedoch nicht bei S/W-Filmen.

Es empfiehlt sich, hierfür so ein Set aus Pinsel, Handschuhen und vor allem größeren Blasebalg am Arbeitstisch liegen zu haben. Als Handschuhe haben sich dünne Nylonhandschuhe als besser gegenüber Baumwollhandschuhen erwiesen, da hier nichts Fusseln kann. Mit solch einem Pinsel (ein Kosmetikpinsel aus der Drogerie reicht), säubere ich die „Hardware“, also die Filmmasken. Glasflächen und die Filme selbst puste ich mit dem Blasebalg ab. Tipp: Man hält alles etwas schräg gegen die Leuchtquelle. Dann sieht man im Gegenlicht jedes größere Staubkorn darauf und es kann weg gepustet werden. Geht dies nicht, säubere ich meine Filme mit einem Brillenputztuch. Dies mache ich seit Jahren so und es gab hierbei noch nie Beschädigungen. Auch Kalkflecken, die manchmal nach der Entwicklung auftauchen, lassen sich so – nach kurzem Anhauchen – entfernen.
Staub ist immer wieder ein Problem bei der analogen Fotografie. Mit solch einem umfassenden Reinigungsset inkl. Pinsel und Blasebalg für Filme, Kameras, Objektive und Vergrößerer entfernen Sie schonend Staub und Verunreinigungen.
Stitchen: Mehr Auflösung als die Kamera erlaubt
Ich nutze zur Digitalisierung meiner Filme eine Kamera mit 24 Megapixel Auflösung. Für das Kleinbild reicht dies locker! Vermutlich würde hier auch eine ältere Kamera mit ca. 12 Megapixel Auflösungsvermögen reichen: Mehr gibt das Kleinbildnegativ oder das Kleinbild-Dia sicherlich eh nicht her. Man würde nur das fotografische Korn vergrößern, nicht aber eine gewisse Struktur (z. B. die Schrift einer Tageszeitung) höher auflösen.
Anders sieht dies bei meinen vielen 6×6 Mittelformatnegativen aus. Wenn ich ein solches abfotografieren möchte, erscheint dieses so im Sucher der Digitalkamera:
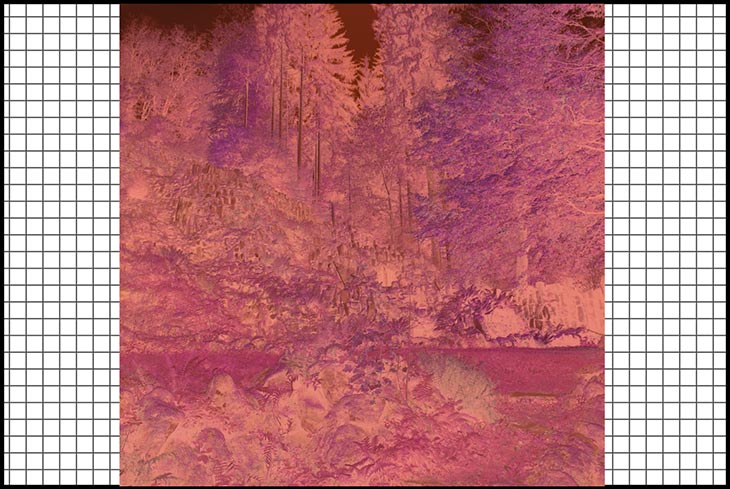
Es sollte hierbei jedoch noch ein Stück vom Negativrand für einen späteren Weißabgleich mit fotografiert werden.
Durch das Quadrat kann ich nicht die gesamte Sensorbreite nutzen. Obwohl das Mittelformatnegativ viel größer ist als ein Kleinbildnegativ, werde ich später eine deutlich geringere Auflösung erhalten: Es passt einfach nicht ins Seitenverhältnis (ca. 1:1,5). Eigentlich widerspricht sich dies. Doch technisch gibt es hierfür die Lösung des „Stitchens“ (englisch für zusammen Nähen): Man näht also zwei oder gar mehrere Makro-Aufnahmen von verschiedenen Elementen des Negativs zusammen (dies geht auch im RAW-Format, s. u.):
Daher fotografiere ich meine Mittelformatfilme je Motiv mindestens zwei Mal: Einmal den oberen Teil und einmal den unteren Teil. Hierbei wird einfach nur die LED-Leuchtfläche verschoben. Alle anderen Parameter bleiben ja gleich! Die Kamera wird dabei nicht berührt. So schaut dies dann bei einem Stitchen aus zwei Einzelaufnahmen aus:
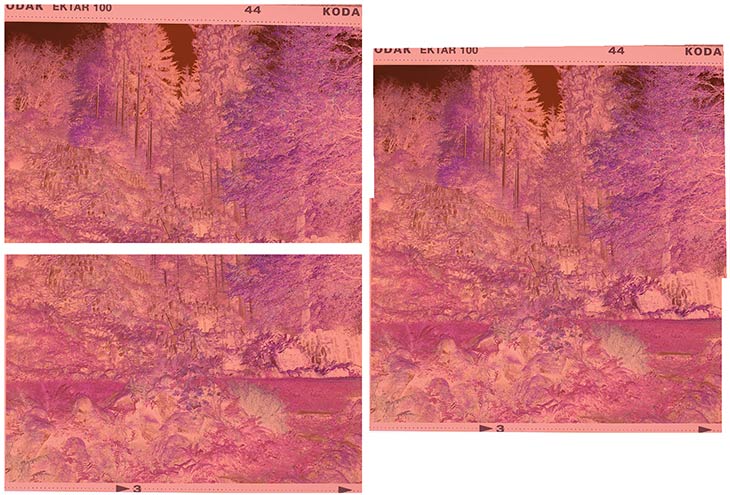
Zunächst wurde der obere Bereich des 6×6-Mittelformat-Negativs formatfüllend fotografiert. Die Leuchtplatte wurde dann auf dem Tisch etwas nach oben verschoben und dann wurde eben der untere Bereich fotografiert. Beide Bilder wurden in Photoshop mittels dem dort integrierten Modul „Photomerge“ per Mausklick zusammen gesetzt. Dies funktioniert hier erstaunlich gut und ohne sichtbare Kanten oder Überlappungen. Die Auflösung wurde somit deutlich erhöht – und zwar optisch und nicht etwa künstlich interpoliert. Nur so kann ich meinem Scanner das Wasser reichen. Es gibt auch andere und auch kostenlose Programme, die so etwas können, z. B. den „Microsoft Image Composite Editor“ oder den „PTGui“. Diese sind eigentlich für das Anfertigen für Panoramas gedacht. Achten Sie daher darauf, dass in den Einstellungen dieser Programme Perspektivkorrekturen nicht vorgenommen werden sollen. Denn die Aufnahmen von der Leuchtplatte sind ja perspektivisch je korrekt.
Insbesondere wegen der Technik des Stitchens nutze ich die vertikale Variante via Leuchtplatte auf einem Tisch. Denn nur so kann man ein großes Negativ (Mittelformat oder gar Großformat) gescheit verschieben bzw. mit der Digitalkamera sozusagen scannen. Nur so digitalisiert man in der hierfür möglichen hohen Auflösung.
Für das Stitchen aus mehr als zwei Einzelaufnahmen (zum Beispiel für ein Großformatnegativ) wird es dann etwas komplizierter. Man bräuchte eine Art Raster zum Verschieben:
Einen Koordinatentisch nutzen
Manche Fotofreunde nutzen zum Stitchen einen sogenannten „Koordinatentisch“. Diese Geräte werden eigentlich für ein präzises Bohren mit der Tischbohrmaschine genutzt. Eine Kamera an einer Reprosäule oder an einem Stativ mit umgedrehter Mittelsäule ist in diesem Sinn ja das gleiche. Solch eine Vorrichtung wird auch unter der Bezeichnung „Kreuztisch“ angeboten – teils auch als Zubehör für Mikroskope
Mittels solch einem Koordinatentisch kann die Vorlage anhand von zwei Drehreglern präzise verschoben- und deren Verschiebung kann anhand von Skalen genau gesteuert (bzw. dokumentiert) werden.
Das ganze ginge sogar automatisiert bzw. computergesteuert:
Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.
Ich verschiebe meine Leuchtplatte aber einfach per Hand. Für Dateien, welche für Drucke bis ca. 50 cm Breite (bei 300 DPI) ausreichen, reicht das (einfache) Zusammensetzen aus lediglich zwei Einzelaufnahmen. Heutige Digitalkameras besitzen ja per se schon eine genügend hohe Auflösung. Anstelle eines Koordinatentisches ginge sicherlich auch einfach ein ausgedrucktes Raster mit Zahlen, welches man unter die Leuchtplatte legt. bzw. eine entsprechende Matte.
RAW-Daten stitchen
Es wäre gut, wenn man im RAW-Modus abfotografiert. Module zur Fabrkonvertierung wie z. B. Negmaster wollen am liebsten Rohdaten (RAW) als Futter. Doch kann man überhaupt RAW-Dateien (z. B. bei Nikon NEF-Dateien) stitchen?
Ja, das geht! Ich nutze Photoshop und im dortigen RAW-Konverter (zumindest bei meiner aktuellen Version) braucht man nur die einzelnen Bilder markieren und per Rechtsklick „Merge to Panorama“ oder so ähnlich wählen. Auch hier sollte man keine Perspektivkorrekturen oder ähnliches wählen. Nach dem Stitchen wurde ein neues RAW, eine DNG-Datei, angelegt. „DNG“ ist so eine Art freies RAW-Format. Nun kann eine einheitliche Bearbeitung dieser Datei vorgenommen werden.
Tethering: Das Bild gleich an den Laptop senden
Eine für fotografische Reproduktionen sehr schöne Möglichkeit ist, wenn man die Digitalkamera mit einem passenden USB-Kabel gleich mit dem Computer bzw. dem Laptop verbindet. Hierfür gibt es für diverse Digitalkameras entsprechende Programme. Wer Adobe Lightroom und eine Nikon oder Canon Digitalkamera verwendet, kann so die abfotografierten Negative bzw. Dias gleich in die Programmbibliothek laden, um sie dort zu bearbeiten. Diese Möglichkeit ähnelt dann sehr dem Scannen. Ein Entfernen der SD-Karte aus der Kamera ist nicht mehr nötig.
Bei für das Tethering spezialisierter Software ergeben sich noch zwei weitere Vorteile:
- Der Fernauslöser ist nicht nötig, da die Kamera direkt mittels der Computertastatur (oder per Mausklick) ausgelöst werden kann. Und:
- Die Bildschärfe kann sofort auf dem Bildschirm kontrolliert werden (und sogar vor der Aufnahme live). Das soeben abfotografierte Negativ erscheint ja sofort auf dem Bildschirm bzw. kann auch zu 100% gezoomt werden. Bevor man ggf. ein Negativ später erneut einlegen muss (weil nicht korrekt fokussiert wurde) sieht man einen solchen Fehler sofort und kann diesen gleich korrigieren.
Für meine Nikon-Digitalkamera kann ich hierfür die Freeware digiCamControl nutzen oder das kostenpflichtige Camera Control von Nikon oder ControlMyNikon. Sicherlich gibt es auch für Canon diverse solcher Programme und auch für Kameras anderer Hersteller.
Je nach Kamera und Software kann auch die LiveView-Funktion genutzt werden. Ich probiere diese einmal mit meinem Aufbau und der kostenlosen Tethering-Software „digiCamControl“ (für Nikon) aus:

Das von der Kamera live gesehene Bild (das Negativ auf meinem Leuchttisch) wird durch ein USB-Kabel an den Computer übertragen. Die Software zeigt mir dieses diekt auf dem Computermonitor an (rechter Monitor). Es ist tatsächlich ein „Live-Bild“. Auf dem linken Monitor sehe ich ein gerade abfotografiertes Bild dieses Negativs. Ich kann es also sofort prüfen. Außerdem kann die Kamera so natürlich direkt über das Programm ausgelöst werden und ich kann sie steuern (Belichtung, ISO-Wert, Weißabgleich, Fokus, Zoom, …). Für mich am interessantesten ist hierbei aber die „Fokus-Lupe“:

Achten Sie hier auf das grüne Rechteck in dieser Live-View-Ansicht. Man kann es verschieben. Ich schiebe es also auf eine besonders prägnante Stelle (hier haben sich einige Leute auf dem alten Kneipenklavier verewigt). Danach klicke ich den Knopf für die 100%-Ansicht an. Vorher werfe ich noch einen Blick auf das Histogramm (links im Bild), ob die eingestellte Belichtung stimmt.
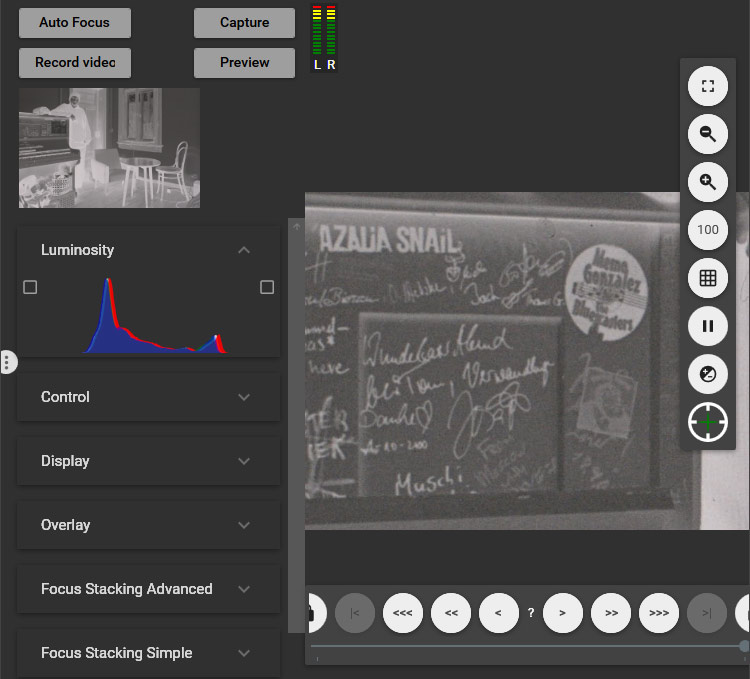
Der markierte Bildbereich wird nun vergrößert (live) dargestellt. Ich kann nun den Fokusring meines manuellen Makro-Objektivs drehen und sehe sofort auf dem großen Monitor eine Veränderung. Wer ein Autofokus-Objektiv besitzt, kann dieses natürlich auch via Software ansteuern. Dieses Programm besitzt zum exakten Scharfstellen übrigens noch ein prima Hilfsmittel: Es lässt sich eine Art „Konturansicht“ hinzu schalten: Das gesamte Bild wird sehr dunkel, nur die Kanten des Bildes sind hell. Je heller sie sind (ideal weiß), desto schärfer ist fokussiert. Dies ist insbesondere für Fotofeunde sinnvoll, denen das Fokussieren durch den winzigen Kamerasucher schwer fällt.
Dieses Tethering ist an sich eine prima Sache. Bei mir stürzt diese Freeware allerdings ständig ab. Ich werde auch nicht so recht warm damit: Mir reicht zum manuellen Fokussieren auf das fotografische Korn der grüne Punkt im Sucher meiner Digitalkamera (oder die interne Live-Ansicht auf dem Display) und zur Kontrolle ein einziger Klick auf die „OK-Taste“, so dass das aufgenommene Bild in der 100%-Ansicht auf dem Display der Digitalkamera erscheint. Hierbei sollte diese natürlich stabil am Stativ sitzen, damit sie sich für die nächsten Aufnahmen nicht verstellt, wenn man daran herum werkelt. Das ist der Sinn hierbei beim Tethering: Die Kamera muss nicht mehr angefasst werden. Bei Makroaufnahmen dient sie sozusagen wie ein „entfesseltes“ Mikroskop.

Das gingt schnell: Das abfotografierte S/W-Negativ wanderte durch das USB-Kabel direkt auf den Computer (inklusive einiger Staubkörner, aber die sieht man bei dieser kleinen Version kaum). Danach musste es noch in ein Positiv umgewandelt werden.
Weiter geht es also mit der Bildbearbeitung der Negative, wenn alle Aufnahmen im Kasten sind:
Die Bildbearbeitung: Umwandlung in ein Positiv
Hinweis: Für Positive (Dias) und S/W-Film reicht kostenlose, „reguläre“ Bildbearbeitungs-Software völlig aus.
Knifflig jedoch wird es häufig bei der Konvertierung eines orangenen Farbnegativs in ein farbrichtiges Positiv. Hier gibt es viele Wege und den einzig wahren habe ich auch noch nicht gefunden.
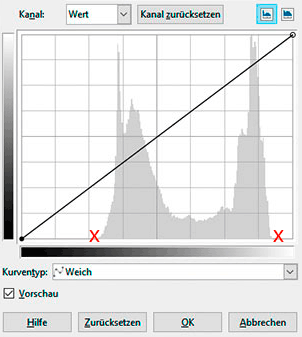
Transferieren Sie ein analoges Medium (Film) in ein digitales (Bilddatei) sollten Sie für einen hohen Anspruch Kenntnisse in der digitalen Bildbearbeitung haben bzw. z. B. wissen, was eine Gradationskurve ist. Idealerweise lassen Sie sich so etwas nicht durch Automatiken abnehmen. Es geht aber natürlich auch ohne solch Hintergrundwissen.
Nach der eigentlichen Aufnahme benötigt man zur Umwandlung natürlich eine entsprechende Software. Der große Vorteil beim Abfotografieren von Dia-Positiven (keine Negative): Oftmals braucht man hierbei gar keine Bildbearbeitung mehr vornehmen, wenn man je Motiv die Parameter der Digitalkamera individuell abgestimmt hat. Häufig muss jedoch noch händisch der Kontrast angepasst werden.
Bei Negativen – insbesondere bei Farbnegativen – sieht dies ganz anders aus. Diese müssen noch in ein stimmiges Positiv konvertiert werden. Hierzu ist eine gute Software unabdingbar. Einige wenige Digitalkameras (Nikon D850) besitzen hierfür in ihrer Firmware ein Menü, mittels welchem so etwas offenbar bereits in der Kamera möglich ist. Besser ist es, man fotografiert „RAW“ und nimmt so etwas auf einem ordentlichen Computermonitor vor, welcher idealerweise profiliert („kalibriert“) ist.
Bei S/W-Negativen ist dies besonders einfach: Man wandelt das Negativ in der Software in ein Positiv um („invertieren“), setzt den Bildmodus auf Graustufen und ändert Kontrast und Helligkeit je nach Vorstellung. Versierte Nutzer einer Bildbearbeitung nutzen hierfür natürlich die Gradationskurve bzw. die Tonwertkorrektur. Ich zeige nun, wie ich dies bei Farbnegativen mache. Ich spiele dies einmal mittels verschiedener Programme durch.
Grundlagen bei der Umwandlung eines Farbnegativ in ein Positiv
Es gibt hierbei für Color-Negative (die, die Orange sind) immer sehr ähnliche Schritte in der jeweiligen Software (häufig auch versteckt unter der Haube):
- Entfernen der Orangemaske
- Umkehren der Farben und Tonwerte (invertieren)
- Weißabgleich → manuell (z. B. auf den Bildrand) oder automatisch
- Anpassen der Gradationskurve (Schatten, Lichter, Gamma)
- optional: leichte Änderung der Farbtemperatur nach Geschmack
- optional: leicht (Vor-) Schärfen
Damit insbesondere Farb- und Helligkeitsveränderungen überhaupt „korrekt“ wahrgenommen werden, empfiehlt es sich, den Laptop bzw. den PC-Bildschirm zu profilieren (kalibrieren).
Ein Kolorimeter wie der Spyder zum Kalibrieren eines jeden Monitors (auch Laptop) ist Voraussetzung dafür, wenn man bei der Bildbearbeitung einen neutralen Farb- und Helligkeitseindruck haben möchte bzw. wenn spätere Drucke (und Web-Ansichten) genau so aussehen sollen, wie man sie vorher am eigenen Computerbildschirm wahr genommen- bzw. eingestellt hat.
Bei jedem guten Bildbearbeitungsprogramm sind diese Werkzeuge vorhanden – auch in den kostenlosen in der Aufzählung. Das Prinzip ist immer sehr ähnlich. Los geht’s zunächst mit einem sehr benutzerfreundlichen Programm:
Mit SmartConvert
SmartConvert ist relativ neu auf dem Markt:
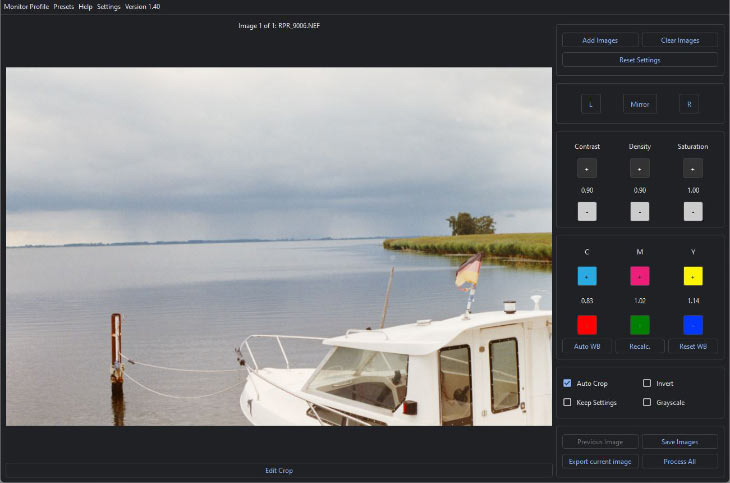
Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen dieses Genres ist SmartConvert besonders simpel in der Bedienung und zaubert häufig sofort ansehnliche Ergebnisse hervor: Bild laden, Auto-Beschnitt, fertig. Es ist kein Add-on für eine andere kostenpflichtige Software, sondern funktioniert für sich alleine. Viel mehr Einstellungsmöglichkeiten wie auf dem oberen Screenshot zu sehen gibt es hier auch nicht.

Es gibt einige Möglichkeiten für manuelle Eingriffe. Das Programm ist jedoch zunächst dafür ausgelegt, dass erst einmal versucht wird, alles automatisch und flott zu konvertieren (insbesondere wenn man sehr viele Bilder einspeist). Es ist das benutzerfreundlichste Programm in dieser Aufzählung und es gibt auch eine kostenlose Testversion. Lesen Sie bei Interesse auch den Artikel → Review Filmomat SmartConvert.
Wer lieber manuell und puristisch mit ggf. vorhandenen Mitteln vorgehen möchte, kann dies auch mit einem Standard-RAW-Konverter versuchen:
Mit Adobe Camera Raw
Adobe Camera RAW (ACR) kennen alle, die mit Photoshop arbeiten (es ist ein vorinstalliertes Plugin). So schaut es aus, wenn ich ein abfotografiertes (oder gescanntes, s. u.) Negativ in ACR lade:
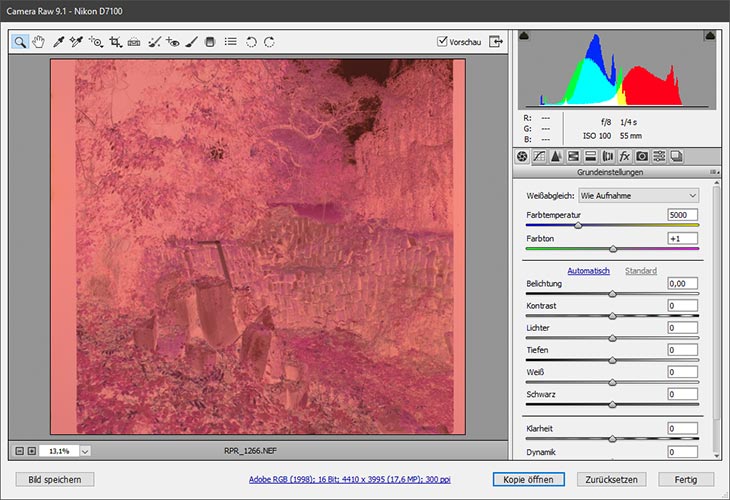
Zwei Dinge hierzu: Wie Sie sehen, habe ich den Bildrand mit abfotografiert. Den brauche ich gleich. Dann sehen Sie auf dem Histogramm dieser Software oben rechts, dass hier nichts beschnitten ist: Die Belichtungszeit an meiner Kamera war korrekt (die Wölbungen befinden sich in der Mitte). Mittels dem Regler „Belichtung“ kann diese nun aber noch angepasst- bzw. ggf. „gerettet“ werden. Idealerweise ist die Kurve am Ende so platziert, wie hier abgebildet, also schön mittig (bei „normalen“ Motiven). Mehr braucht man hier erst einmal nicht tun.
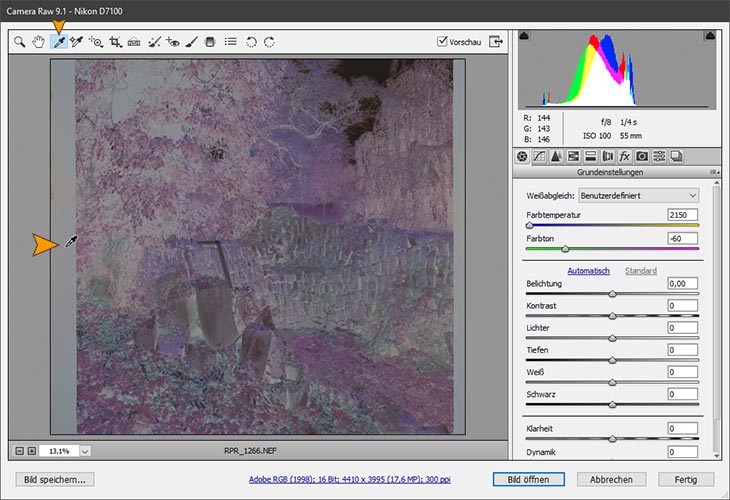
Nun wird mittels der Pipette ein manueller Weißabgleich auf den Filmrand gesetzt. Die Orange-Maske wird hierbei weg gerechnet. Dies geht vermutlich umso präziser, je besser die Qualität der Leuchtplatte bei der Aufnahme war (Stichwort: CRI-Wert bzw. Farbwiedergabeindex). Beachten Sie auf diesem Screenshot auch das Feld rechts oben „Farbtemperatur“: Durch den manuellen Weißabgleich auf den Filmrand befindet sich dieser Regler nun fast am „Anschlag“ links. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, dass idealerweise durch einen Blaufilter digitalisiert werden sollte. Denn dann muss die Software nicht mehr so viel tun. Bei meinem Farbfilm bei diesem Beispiel funktionierte dies auch ohne Blaufilter noch (wenn auch knapp).
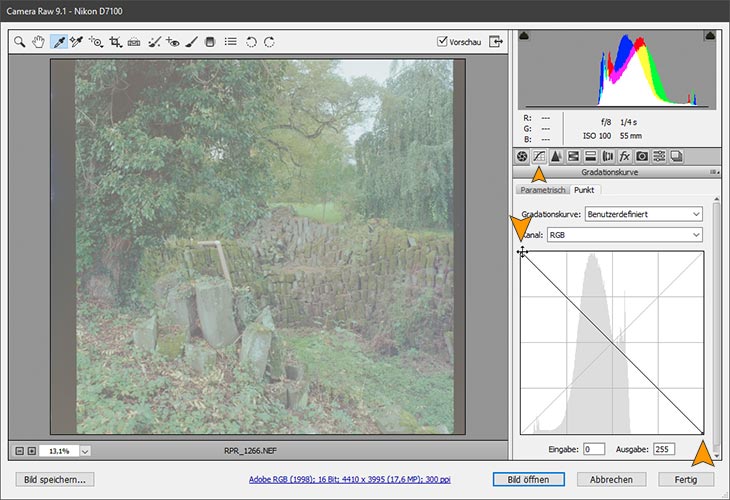
Nun wechsele ich oben in den Reiter „Gradationskurve“. Ich verschiebe die Kurve so, dass hier ein Kreuz entsteht: Ich greife den Punkt links unten und ziehe in nach links oben. Ich greife den Punkt rechts oben und ziehe ich nach rechts unten: Ich invertiere das Negativ in ein Positiv. Hiermit erhalte ich ein „lineares“ Bild mit viel Reserve links und rechts im Histogramm.
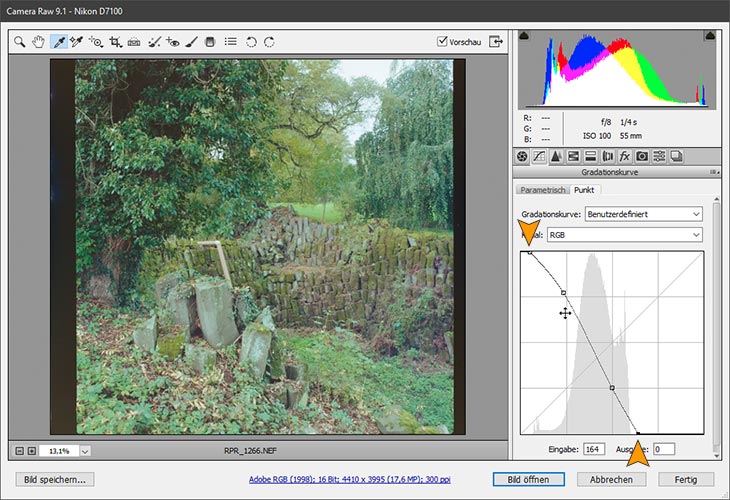
Nun wird noch der Kontrast angepasst, indem beide Punkte nah an die Kurve heran geschoben werden. Oftmals ist es sinnvoll, wenn man aus der Diagonalen noch eine leichte S-Kurve formt („Gamma“, siehe Bild). Hinweis: Es empfiehlt sich, für diesen Schritt den (nun schwarzen) Rand abzuschneiden. Dieser irritiert die Anzeige des Histogramms etwas in den Schatten. Das selbe gilt für einen Bereich, bei welchem die Leuchtplatte vielleicht „nackt“ mit abfotografiert wurde.
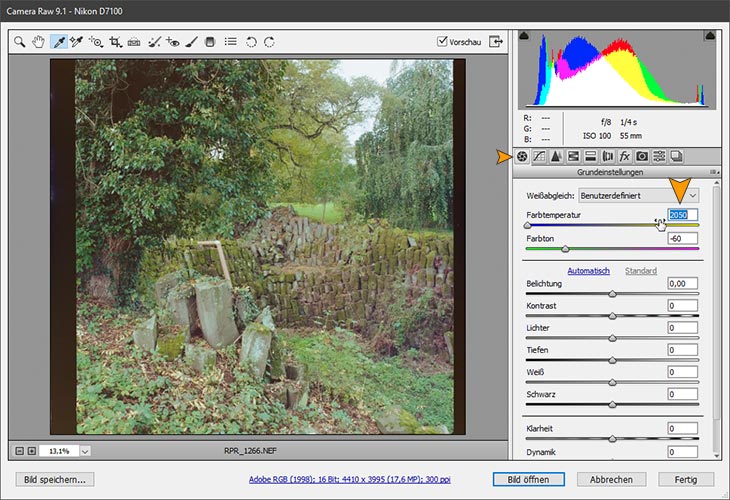
Mein Herbstmotiv erscheint auf der vorherigen Abbildung noch etwas kühl. Also wechsele ich zurück in den Reiter „Grundeinstellung“, setze den Mauszeiger in das Feld „Farbtemperatur“ und verstelle mit den Cursortasten (Pfeiltasten auf der Tastatur) diesen Wert. Ein Tippen nach unten reicht und die Farbtemperatur wird etwas wärmer. Fertig!
Ein extra Film-Plugin (z. B. NEGMASTER für Photoshop oder Negative Lab Pro für Lightroom) ist hier meiner Erfahrung nach am besten geeignet.
Natürlich können Sie jetzt noch andere Einstellungen (Schärfe, Dynamik, …) ändern. Zudem kann man diese Einstellungen auch als „Vorgabe“ speichern (vorletzter Reiter oben von rechts) und für spätere Dateien auf einmal anwenden.
Via den Knopf „Bild öffnen“ wird die Grafik in Photoshop geladen. Hier erfolgen bei mir meist noch andere Bildbearbeitungsschritte. Ich hatte darüber sogar einmal einen Artikel verfasst → Digitale Bildbearbeitung wie im Fotolabor. Tipp: Halten Sie im Konverter die Umschalttaste gedrückt, können Sie das Bild auch als „Smart-Objekt“ öffnen – und somit den RAW-Converter bzw. dessen Einstellungen später jederzeit wieder aufrufen.
Adobe Photoshop + Lightroom im günstigen Jahresabo. Photoshop CC ist die Referenz, wenn es um konkrete Bildbearbeitung geht. Mit Lightroom bearbeiten Sie Bilder simpler und ordnen Ihre Fotosammlung.
Falls Sie auch scannen: Wenn Sie Photoshop installiert haben, lassen sich auch z. B. JPG-Dateien oder Tiff-Daten in Camera Raw mit einem Trick öffnen (per Datei öffnen als [Camera Raw]). Die neueren Versionen können dies auch über den Reiter „Filter“. Ich scanne Negative immer im Dia-Modus und öffne diese im Raw-Konverter. Von der Behandlung von JPG-Dateien rate ich hierbei ab. Aber mit Tiff-Negativen (aus dem Scanner) habe ich mit dieser Methode sehr gute Ergebnisse erlangt. Besser wäre vermutlich (falls möglich) das DNG-Format. Mit etwas manueller Arbeit gelangt man hierbei meist zu wesentlich besser ausgefilterten Bildern als es bei den internen Korrekturen der Scan-Software möglich ist. Wichtig ist immer der Weißabgleich auf den Filmrand und das Scannen bei 16 Bit im DNG- oder wenigstens Tiff-Format im Dia-Modus (Negativ bleibt Negativ), wobei möglichst alle „Sonderfunktionen“ deaktiviert bleiben sollten (Rohscan). Dies sind dann die gleichen Ergebnisse, die man durch das Abfotografieren via Digitalkamera erlangt.
Mit Negmaster (Photoshop-Plugin)

Wer primär Photoshop nutzt, sollte sich einmal das Plugin Negmaster (englischsprachige Internetseite) ansehen. Die oben vorgestellte Methode mit dem RAW-Konverter funktioniert manchmal überraschend gut. Bei anderen Motiven oder Filmtypen schlägt sie wiederum fehl. Man ist hier mit einem solchen Plugin besser bedient, wenn man viel digitalisiert. Es zaubert aus Negativen, mit denen man bisher immer Probleme hatte, oft erstaunlich gute Bildergebnisse hervor. Dafür kostet das Plugin derzeit fast 80 Euro und: Es funktioniert – laut FAQ des Entwicklers – nur mit neuereren Photoshopversionen (ab CC 2018), nicht aber mit der CS6.
Ich habe NEGMASTER mittlerweile testen können und bin sehr angetan von den Ergebnissen: Meine Praxis mit Negmaster
Mit ColorPerfect (Photoshop-Plugin)
ColorPerfect ist vermutlich das bekannteste Photoshop-Plugin für diese Zwecke, weil es bereits ziemlich lange existiert bzw. häufig besprochen wurde. Ich hingegen hatte nur ganz kurz die Testversion ausprobiert. Auch hier erhielt ich sofort gute Negativkonvertierungen. Das Programm scheint mir allerdings recht komplex in der Bedienung zu sein. Man müsste sich hierfür Zeit nehmen. Getestet hatte ich diese Software bisher nicht. Das Programm kostet derzeit ca. 80 €.
Mit Grain2Pixel (kostenloses Photoshop-Plugin)
Noch ein Photoshop-Plugin, aber ein kostenloses: Grain2Pixel. Bis dato hatte ich es noch nicht getestet, auch weil ich eine Negmaster-Lizenz habe.
Mit RAWTherapee (kostenlos)
Eine recht opulente Software ist RawTherapee. Das Programm ist kostenlos. Dieses kann ebenfalls Ihre RAW-Dateien aus der Kamera öffnen bzw. bearbeiten. Dies geht in wenigen Schritten. Ich zeige sie gleich. Zuvor sollten Sie sich ggf. in die Grundfunktionen von RAWTherapee einlesen. Kurz: Es ist eine Bilddatenbank und jedes Foto kann bearbeitet werden. Da hierbei aber nicht direkt in die Bilddatei eingegriffen wird, kann jeder Schritt jederzeit verändert- bzw. rückgängig gemacht werden. Ein finales Bild wird zur Weiternutzung exportiert bzw. heraus gerechnet. Eine Alternative zu dieser Software ist das ebenso kostenlose „Darktable“. Damit gelang es mir jedoch nicht, ein abfotografiertes Negativ stimmig in ein Positiv umzuwandeln. Das kommerzielle Vorbild dürfte Lightroom von Adobe sein. Das schaue ich mir auch gleich an. Zuvor geht es mit RAW Therapee weiter:
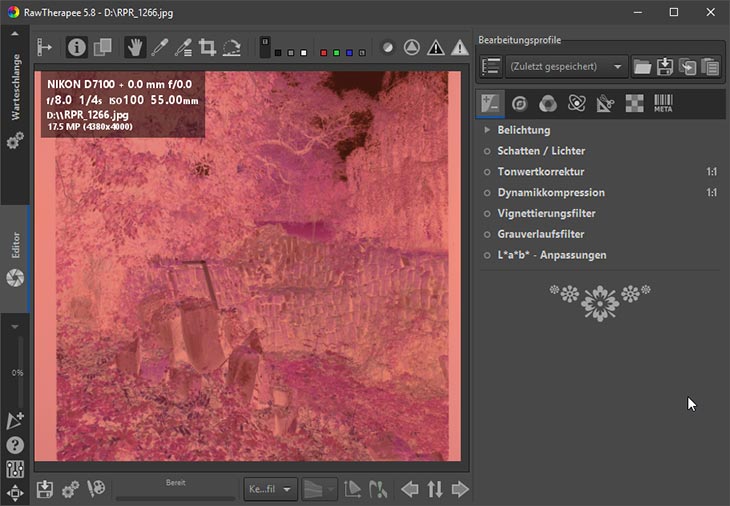
Zunächst wird das Negativ in Raw-Therapee geladen. Auch hier ist es wichtig, dass der Bildrand mit abgebildet wird!
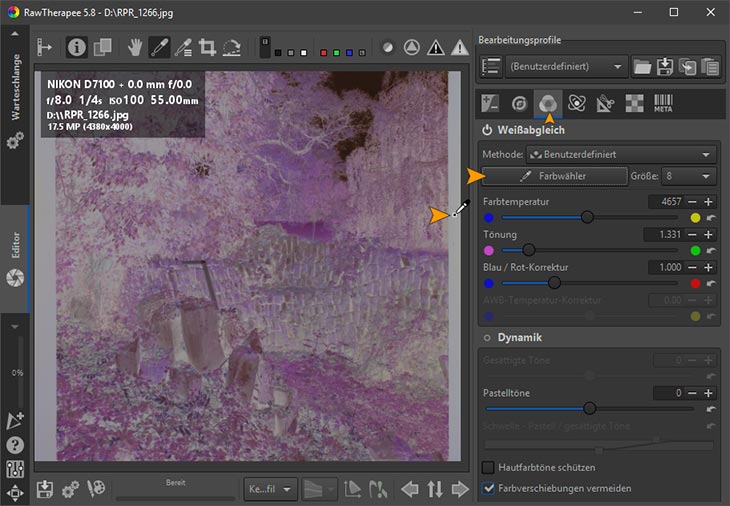
Denn auf den Bildrand wird nun ein manueller Weißabgleich gemacht. Es ist hier alles das selbe Prinzip wie beim oben besprochenen Adobe Camera Raw. Die Pipette ist hier jedoch etwas versteckt: Man wählt oben den Reiter „Farbe“ und dann sucht man sich das Feld „Weißabgleich“. Dort klickt man auf „Farbwähler“ und die Pipette erscheint (ggf. vorher das Feld „Methode“ auf „Benutzerdefiniert“ stellen). Mit der Pipette klickt man nun auf eine Stelle des Negativrandes. Sofort wird die Orange-Maske weg gerechnet.
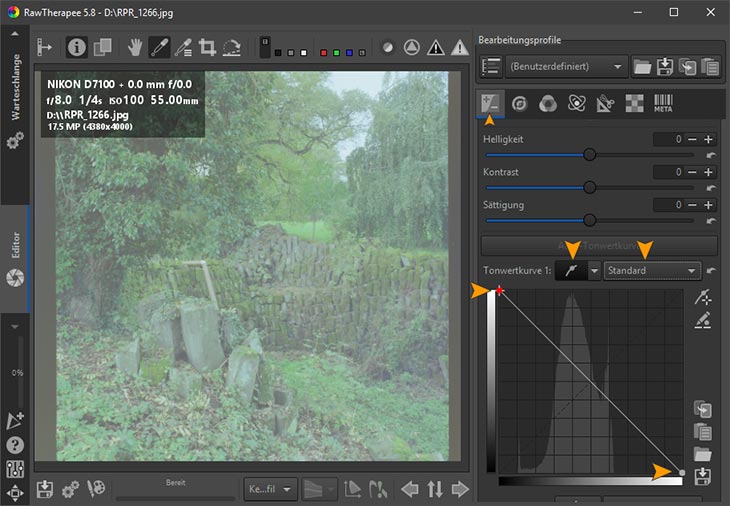
Als nächstes Klickt man oben auf den Reiter „Belichtung“ und scrollt runter zum Punkt „Tonwertkurve 1“. Dort stellt man den Modus auf „Standard“. Das daneben stehende Feld muss ebenfalls auf „Standard“ stehen. Nun erst erscheint die Kurve.
Man zieht den Punkt links unten nach links oben. Dann zieht man den Punkt rechts oben nach rechts unten. Man invertiert das Negativ damit in ein Positiv. Die Diagonale muss bei Ihnen jetzt so ausschauen wie bei dem obigen Screenshot und Ihr Foto muss jetzt ein Positiv sein.
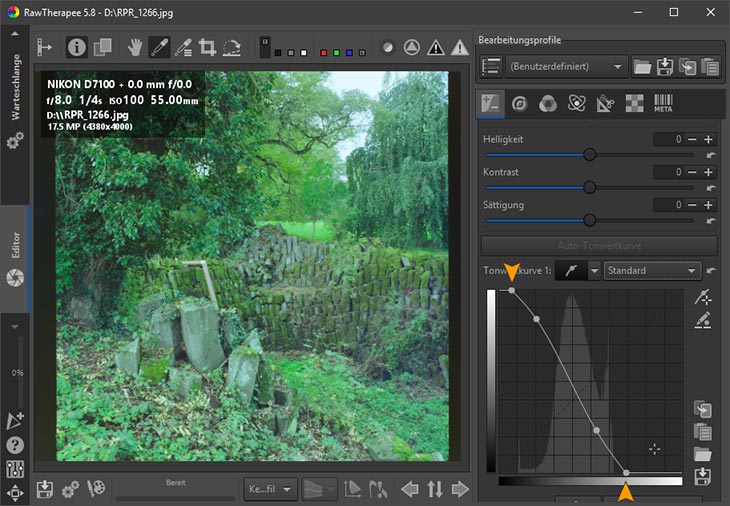
Da das Bild noch viel zu blass war, wird mit der Kurve gleich der Kontrast angepasst: Schieben Sie die die beiden äußeren Punkt bis kurz vor die Kurve. Zusätzlich können Sie noch zwei weitere Punkte via Klick anlegen und diese leicht nach oben bzw. unten verschieben. Sie erzeugen so eine leichte S-Kurve. Das Foto ist noch etwas kühl, daher erfolgt noch eine letzte Änderung:
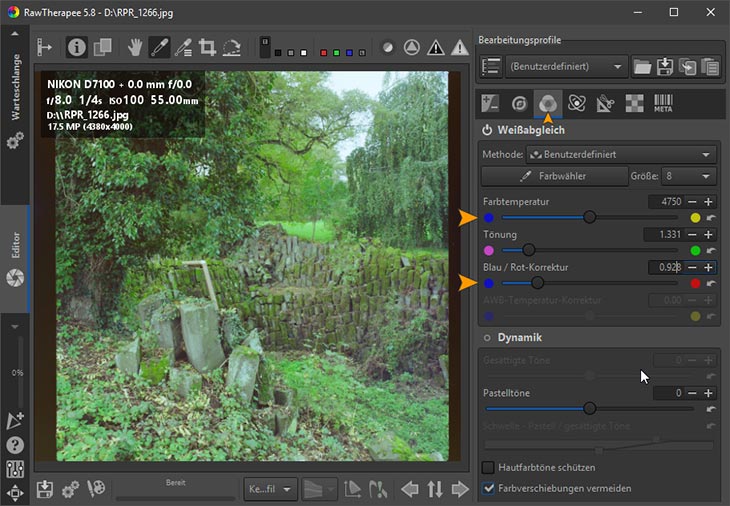
Wechseln Sie zurück zum Reiter „Farbe“ und scrollen Sie runter zu „Farbtemperatur“ bzw. „Blau / Rot-Korrektur“. Hiermit habe ich die Farbtemperatur leicht „wärmer“ eingestellt. Sie können natürlich auch mit den vielen anderen Reglern experimentieren. Dank der „RAW-Funktionalität“ dieser Software kann jeder Schritt später ja wieder rückgängig gemacht- bzw. geändert werden.
Mir gefällt das Ergebnis von Camera RAW besser. Dies liegt offenbar tatsächlich daran, dass ich bei RAWTherapee eine JPG-Version importierte: Man sollte so etwas möglichst mit den RAW-Daten vornehmen. Dies soll auch kein Programmvergleich sein, sondern es soll gezeigt werden, welche wenigen manuellen Schritte hier nur nötig sind, um ein vorzeigbares Ergebnis der abfotografierten Farbnegative zu erhalten. Es ist mit beiden Programmen sehr einfach!
Ich habe dies auch mit dem kostenlosen Gimp ausprobiert. Meine Vorgehensweise mit dem manuellen Weißabgleich und der Kurve funktioniert dort allerdings nicht. Man müsste die einzelnen RGB-Kurven verschieben, was ich lästig und ungenau finde. Ich hatte dies einmal dokumentiert → Rohscan mit Gimp ausfiltern.
Mit Darktable und dem Negadoctor-Modul (kostenlos)
Ich hatte auch das ebenfalls kostenlose Darktable ausprobiert. Dass hierbei meine gewohnte RAW-Umwandlung nicht wie gewünscht funktionierte, schrieb ich ja bereits. Aber Darktable besitzt ein extra Negativ-Umwandlungsmodul „Negadoctor“:
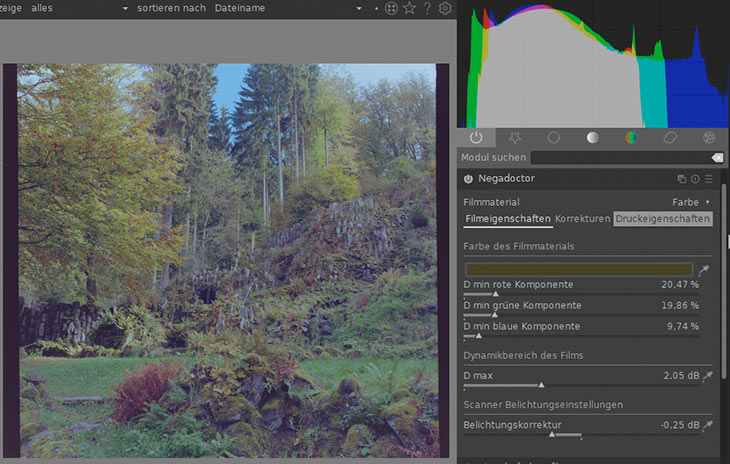
Dieses Modul arbeitet jedoch ganz anders als bei den drei Raw-Konverter-Schritten. Negadoctor arbeitet eher wie z. B. „Negafix“ im Scan-Programm SilverFast: Man weiß nicht so recht, was da eigentlich unter der Haube passiert. Bei meinem Beispielbild (diesmal ein anderes Motiv) gelang ich nur durch Gefrickel zu einem einigermaßen korrekt ausgefilterten Bild. Wenn Sie bei kostenloser Bildbearbeitung bleiben möchten, probieren Sie diesen Weg durchaus einmal aus. Vielleicht haben Sie mehr Gefallen daran als ich.
Holzhammer-Methode: Auto-Weißabgleich / Auto-Farbkorrektur
Jede gute Bildbearbeitungs-Software bietet automatische Funktionen für etwa einen automatischen Weißabgleich oder eine automatische Farbkorrektur. Ich habe jetzt doch noch einmal Gimp hervor geholt, das Negativ invertiert (Reiter: Farben → Invertieren) und einen automatischen Weißabgleich angewandt (Reiter: Farben → Automatisch → Weißabgleich):
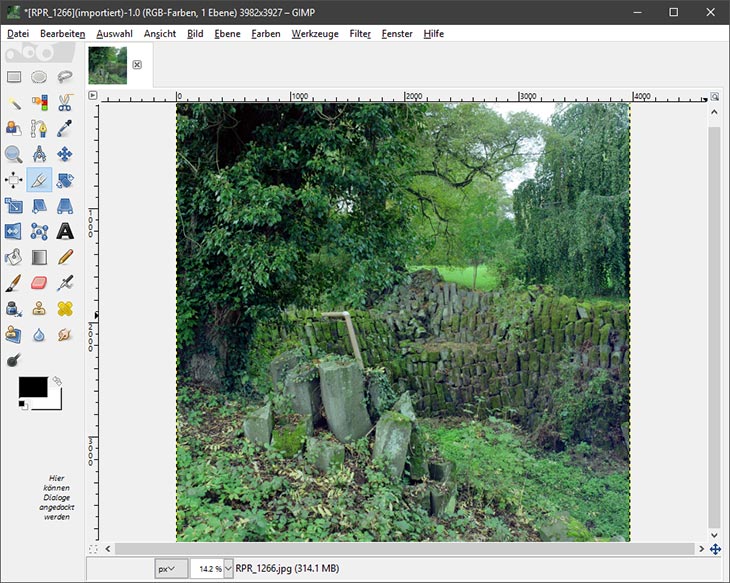
Bei meinem Motiv funktioniert dies sogar recht gut. Allerdings sind die Schatten recht „harsch“, der Kontrast ist relativ hoch und ich hatte keine Möglichkeit, dies zu steuern. Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Automatikfunktionen bei vielen Farbnegativen nicht ordentlich funktionieren. Bei dieser „Holzhammermethode“ sollte kein Negativrand mit abgebildet sein.
Mit Lightroom + Negative Lab Pro Plugin
Eine der beliebtesten Methoden, um sehr schnell ein abfotografiertes Negativ umzuwandeln ist das Plugin „Negative Lab Pro“. Es muss hierfür zwingend das Programm „Adobe Lightroom“ vorhanden sein. Beides kostet Geld. Über dieses tolle Plugin hatte ich auch einen ausführlichen Artikel geschrieben → Negative Lab Pro für Lightroom. Doch hier fasse ich mich kurz:
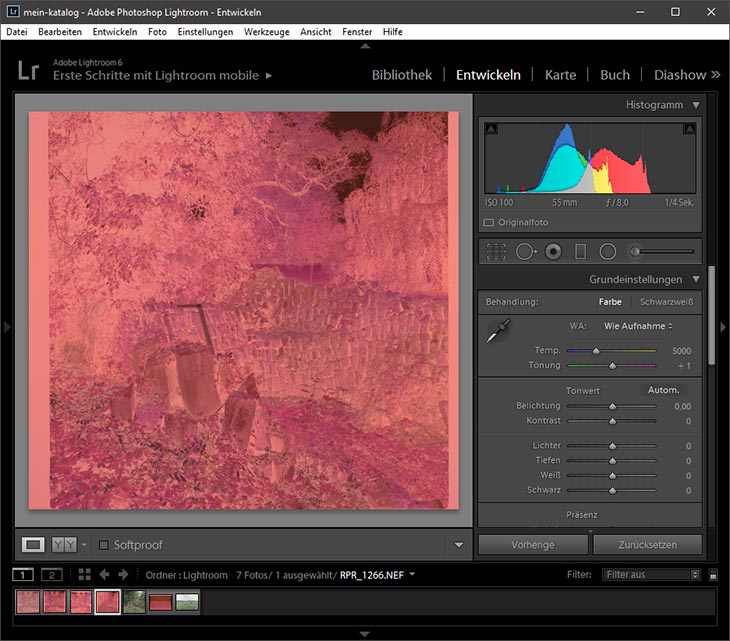
Zunächst wird die Bilddatei des vorher digitalisieren Negativs in die Software Lightroom geladen.
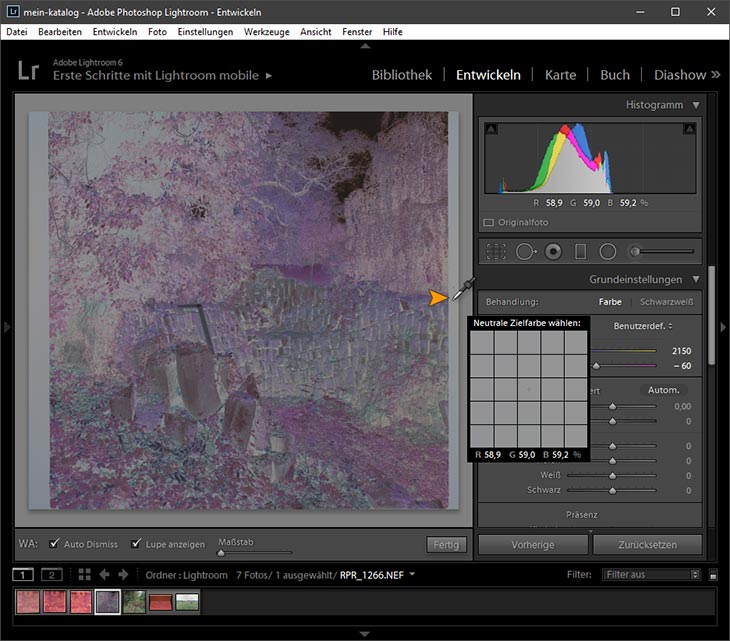
Auch hier wird ein manueller Weißabgleich auf den Filmrand des abfotografierten Farbnegativs vorgenommen.
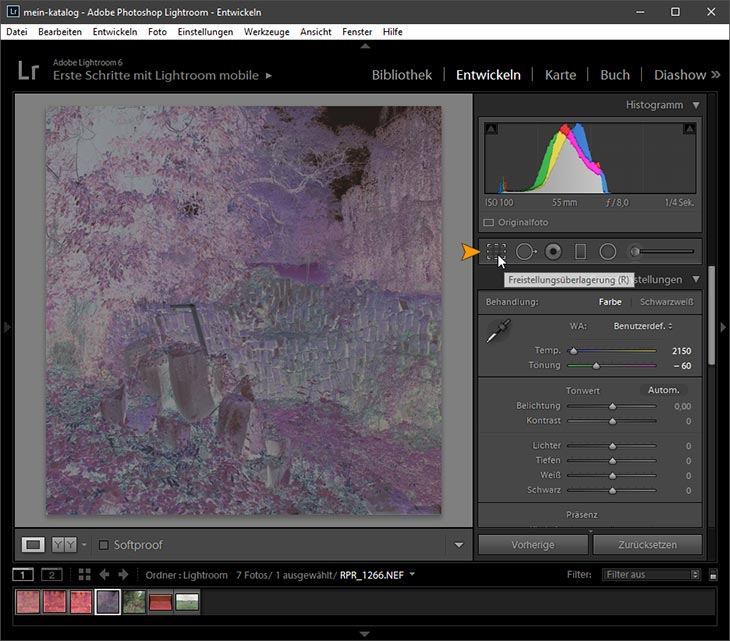
Allerdings muss dieser Rand nun (erst einmal) weggeschnitten werden. Ansonsten wird das gleich folgende Plugin irritiert. Dies kann später wieder rückgängig gemacht werden, falls man den schwarzen Bildrand behalten möchte.
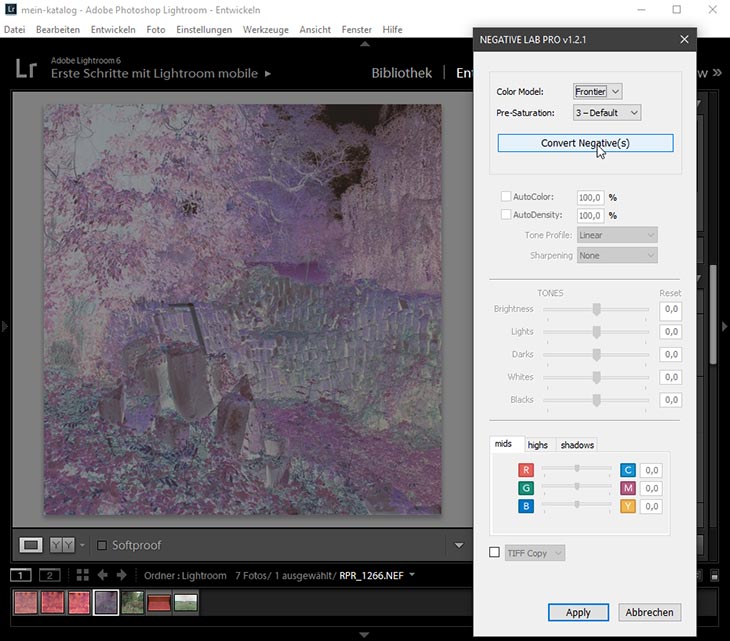
Über den Reiter: Datei → Zusatzmoduloptionen wird Negative Lab Pro geöffnet. Das sieht dann erst einmal so aus. Man klickt nun einfach auf „Convert Negative(s)“.
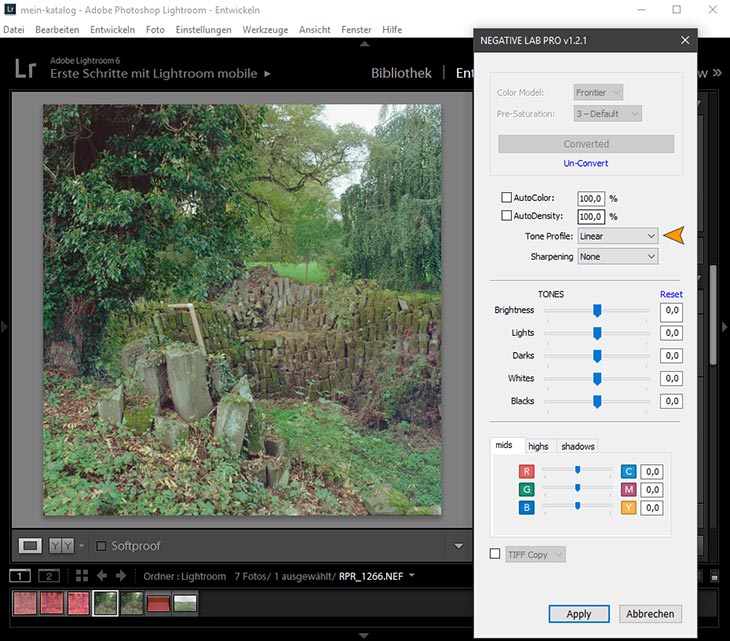
Fertig. Das Plugin hat mir ein sehr stimmiges Positiv heraus gerechnet. Das funktioniert (im Gegensatz zu den internen Auto-Funktionen der Bildbearbeitungsprogramme) überraschend gut und bei mir bei fast allen Farbnegativen. Ich selbst wähle in den Einstellungen nur unter „Tone Profile“ „Linear“. Denn ich ändere den Kontrast später. Auch einen Schärfe-Filter wende ich hier noch nicht an. Andere Einstellungen nehme ich bei dieser Software selten vor.
Mit dieser Lizenz können Sie ein Jahr Adobe Lightroom nutzen: Mit Lightroom bearbeiten Sie Fotografien mit modernen Werkzeugen (das Original bleibt unangetastet) und erstellen einen sehr übersichtlichen Katalog Ihrer Sammlung.
Als Photoshop-Alternative zu Negative Lab Pro wäre Negmaster zu nennen.
Mit VueScan
Wer sich für das Scannen von Filmen interessiert kennt sicherlich das Programm „VueScan„. Es wird von Vielen hierfür bevorzugt genutzt (und kostet etwas Geld). Im Gegensatz zu vielen anderen Scan-Programmen kann es auch eine Datei scannen. VueScan ist eigentlich recht simpel in der Bedienung. Es spielt hier durchaus eine Rolle, welche Art von Datei man importiert: VueScan kann nämlich auch RAW-Dateien öffnen und hier gelingt mir die automatische Farbausfilterrung viel besser als bei „fertigen“ Tiff- oder JPG-Dateien:
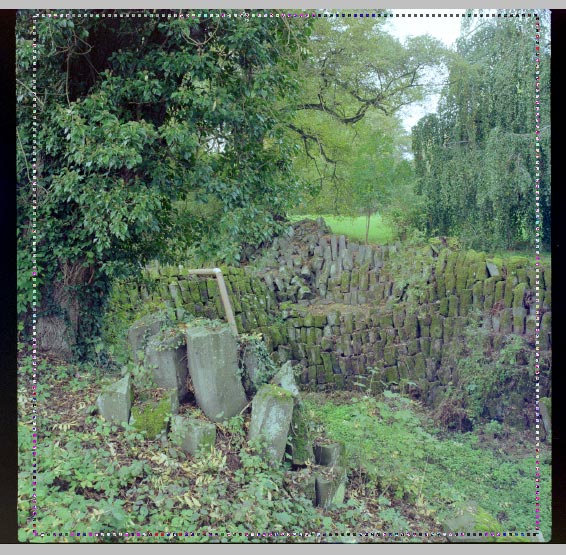
Die RAW-Datei aus der Kamera wurde direkt in Vuescan geladen bzw. on the fly umgewandelt. Das Ergebnis sieht viel stimmiger aus, als ich zunächst angenommen hatte. Denn bisher habe ich schlechte Erfahrungen mit solchen Scanprogrammen gemacht, wenn es darum geht, gescannte Farbnegative automatisch auszufiltern. Wichtig ist hierbei, dass man den Rahmen nicht auf den Negativrand verschiebt (siehe Bild). Und das sind die wenigen hierfür relevanten Grundeinstellungen:
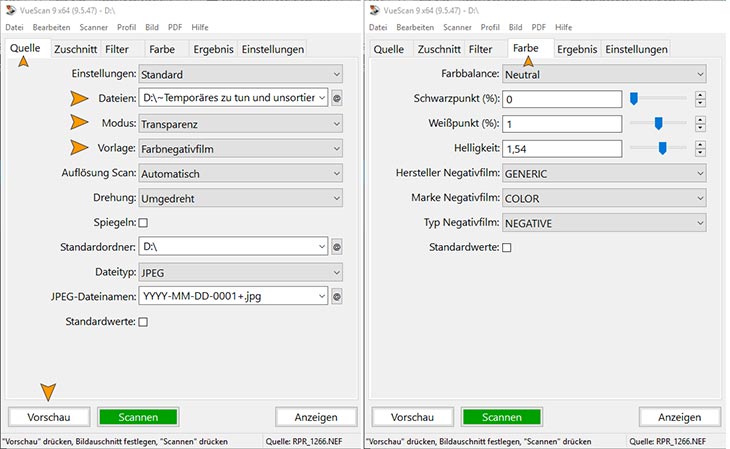
Um nun nicht einen Scanner mit VueScan anzusprechen, sondern eine Bilddatei zu laden, muss im Reiter „Quelle“ unter „Dateien“ einfach die gewünschte Bilddatei ausgewählt werden. idealerweise laden Sie hier eine RAW-Datei, also einfach das Foto, wie es direkt aus der Kamera kommt (Hinweis: Im Öffnen-Dialog auch schauen, dass unten rechts „alle Dateitypen“ ausgewählt ist) . Danach muss unten auf „Vorschau“ geklickt werden.
Der Modus ist hier „Transparenz“ und die Vorlage ein „Farbnegativfilm“. Im Reiter Farbe steht die „Farbbalance“ auf „Neutral“. Die Helligkeit habe ich etwas angehoben. Ansonsten wurde nichts verändert. Obacht: Der Rahmen sollte so um das Bild gezogen werden, dass der Bildrand weg ist. Zum abspeichern muss nun einfach auf „Scannen“ geklickt werden.
Da man hier weder einen Weißpunkt setzen- noch eine Kurve anpassen muss (nicht kann), zählt die Variante mit VueScan zu den bisher schnellsten bzw. einfachsten mit ordentlichem Ergebnis. Voraussetzung: Eine RAW-Datei sollte geladen werden (kein Tiff, kein JPG). Auf der Internetseite hierzu gibt es auch eine Testversion zum Download. Probieren Sie es mit den RAW-Dateien Ihrer Digitalkamera aus.
Ein Gedanke zu den Bilddateien
Es hat sich bei meinen Vergleichen heraus gestellt, dass die RAW-Dateien aus der Digitalkamera (abfotografierte Farbnegative) einfacher innerhalb entsprechender Software in einigermaßen neutrale Farbbilder umgewandelt werden können. Was hatte ich mich dabei in den letzten Jahren schon gequält, wenn es darum ging, entsprechende Tiff-Dateien aus dem Scanner umzuwandeln. Meine Vermutung: Diese RAWs besitzen einfach mehr Fleisch. Ich glaube fast, dass die Hersteller von Scannern in ihrer Forschung bereits vor einigen Jahren „eingeschlafen“ sind. Digitalkameras hingegen wurden immer besser und das macht sich dann bemerkbar, wenn man diesen Output weiter verarbeiten (umwandeln) muss. Dies ist aber nur eine Vermutung. Falls man einen Scanner nutzt, empfehle ich heute immer, möglichst eine Scansoftware zu nutzen, welche die Daten im DNG-Format ausgeben kann (VueScan kann dies und auch die SilverFast Archive Suite).
Bildvergleich mit einem Epson V750 Scanner
Ich besitze einen Epson V750 Pro Scanner, welcher durchaus sehr gute Ergebnisse produziert, wenn man bei ihm darauf achtet, dass die Filme planparallel im Fokus liegen – also wie beim Abfotografieren. Ich habe einmal ein Motiv mit den bei mir besten Einstellungen gescannt und vergleiche dieses mit der abfotografierten Version:

Dies ist das 6×6-Negativ bzw. das Bild, welches ich gerne für diese Tests nutze, denn ganz hinten befindet sich ein Stück Bauzaun:

Tatsächlich erscheint das Ergebnis des abfotografierten Negativs zunächst einen Tick besser! Allerdings muss man hierbei bedenken, dass insbesondere die Scans der Epson Negativscanner noch tüchtig geschärft werden können (insbesondere nach einem Mehrfachscan). Bei beiden Aufnahmen wurde noch gar nichts geschärft (auch nicht im Scan-Programm bzw. im RAW-Konverter).
Zudem musste ich das Negativ mit der Digitalkamera zweimal je versetzt abfotografieren bzw. stitchen. Mit nur einer einzigen Aufnahme kommt man nicht zu solch einer hohen Auflösung. Mit dem Scanner geht es in einem Rutsch.
Scannen oder Abfotografieren?
Dass mit beiden Varianten sehr gute Digitalisierungen zu schaffen sind, zeige ich auf dieser Seite. Ich nutze den Epson V750 pro und erhalte mittels diesen Tipps hochwertige digitale Daten meiner Negative. Genau so gut geht es mit dem Abfotografieren via Digitalkamera und Leuchtfläche. Was man hierbei alles beachten sollte, lesen Sie ja in diesem doch recht langen Ratgeber.
Es gibt einige Vorteile bei solch einem Scanner:
- Stitchen bzw. das Zusammensetzen aus mehren Einzelaufnahmen ist hier nicht nötig: Man kann selbst große Planfilme in einem Durchgang (bei riesiger Auflösung) scannen. Für das Digitalisieren von Kleinbild-Filmen (24 x 36 mm Bilder) spielt dies aber keine Rolle. Denn hierfür bietet die (moderne) Digitalkamera bei nur einer Einstellung eine genügend hohe Auflösung.
- Man muss keine Sorge haben, dass die Bildränder bzw. Bildecken unschärfer sind als das Zentrum. Alles wird gleichmäßig gescannt, da die Scanner-Optik überall gleich abbildet. Natürlich muss der Film auch hier planparallel montiert sein bzw. genau „im Fokus sitzen“ (Dieser Punkt wird häufig nicht beachtet).
- Gute Scanner besitzen eine automatische Staub- und Kratzerentfernung auf der Grundlage eines Infrarot-Scans. Sehen Sie sich hierzu das Bildbeispiel auf der Seite der Firma LaserSoft an. Solche Störungen müssen hier nicht händisch retuschiert werden (gilt nur für Diafilme und Farbnegativfilme) und kann beim Digitalisieren von ganzen Archiven eine ganz erhebliche Arbeitserleichterung sein, wenn die Vorlagen verschmutzt oder gar zerkratzt sind.
- Man scannt unbeaufsichtigt: Einmal eingelegt, werkelt der Scanner vor sich hin und digitalisiert z. B. 24 Kleinbild-Negative, ohne dass man noch etwas machen muss.
Außerdem kann natürlich in einem hellen Raum gescannt werden. Ein Abdunkeln (wie bei manchen Vorrichtungen zum Abfotografieren) ist nicht nötig. Zudem: Steht das Gerät einmal auf dem Tisch, muss nichts mehr ausgerichtet / eingerichtet werden. Der ganze Aufbau entfällt. Man muss auch nicht bei jedem Bild die Schärfe kontrollieren (wenn man Bange hat, dass sich diese verstellt). Wenn man mal eben ein, zwei Motive digitalisieren möchte, muss man nicht den ganzen Aufwand betreiben, eine Kamera planparallel zu montieren. Bei mir dauert dies jeweils ca. 20 Minuten mit dem Aufbau der Digitalkamera.
Verabschieden Sie sich aber von dem Gedanken, dass nach dem Klick auf „Scannen“ gleich korrekt ausgefilterte Bilder auf der Festplatte abgespeichert werden. Das funktioniert nur mit Glück und gefühlt nach dem Zufallsprinzip. Ich fertige unbearbeitet „Rohscans“ an (ich scanne alles [auch Negative] im Dia-Modus) und bearbeite diese Grafiken stets in einer Bildbearbeitung – genau so also wie beim Abfotografieren. Für „normale“ Ansprüche wird die Automatik der Scan-Software sicherlich auch gute Dienste leisten – besonders wenn es einfach nur darum geht zu archivieren und Störungen (Kratzer & Staub) automatisch zu korrigieren.
Oft wird gesagt, scannen dauert viel länger als das Digitalisieren mittels Digitalkamera. Man bedenkt hierbei aber nicht, dass ein Scanner unbeaufsichtigt scannen kann: Man kann bei einem Epson V800 bis zu 24 Kleinbildnegative einlegen, den Deckel schließen und den Scan-Vorgang starten. Alle Bilder werden dann nacheinander automatisch als Positive auf der Festplatte abgespeichert. Bei Farbfilmen wird zudem automatisch Staub entfernt (zusätzlicher Infrarotscan). In dieser Zeit kann man Kaffee trinken gehen. Bei Abfotografieren muss man jedes Bild einzeln fotografieren bzw. nacheinander in den Halter einlegen / ausrichten (und zuvor penibel säubern). Idealerweise findet dies in einem dunklen Raum statt, wenn man als Lichtquelle eine Leuchtplatte nutzt. Für jeden Bildwechsel muss man dann das Raumlicht einschalten bzw. danach wieder ausschalten. Man muss hier also sehr aufmerksam und gründlich arbeiten, wenn man Wert auf eine möglichst hohe Qualität legt – Ja: Es ist dann tatsächlich Arbeit (die einem ein Scanner abnimmt).
Es gibt natürlich auch Vorteile beim Abfotografieren:
Besitzen Sie bereits eine gute Digitalkamera (hohe Auflösung, manueller Modus), brauchen Sie nur noch ein Stativ, eine Leuchtplatte und ein Makro-Objektiv (ggf. noch einen Zwischenring), zudem einen gescheiten Filmhalter.
In der Summe erreicht man damit schnell den Preis eines Epson V800. Braucht man noch eine gute Digitalkamera, wird es allerdings recht teuer. Aber viele dieser Dinge kann man auch günstig gebraucht kaufen und: Diese sind natürlich auch für andere fotografische Ideen relevant! Ich nutze mein 55 mm Makroobjektiv auch als „normales“ Objektiv und mein Stativ nehme ich natürlich auf vielen Fototouren mit. Mit der Digitalkamera mache ich freilich auch andere Dinge als technische Reproduktionen. Auf meiner Leuchtplatte beurteile bzw. sichte ich meine Filme. Den Scanner hingegen nutze ich nur fürs Filme Digitalisieren. Diese Geräte sind häufig recht groß. Ein Scanner steht dann die meiste Zeit ungenutzt herum. Ich pflege einen sehr minimalistisch gehaltenen Hausstand: Eine Leuchtplatte und der Filmhalter verschwinden elegant in der Schreibtischschlublade. Kamera, Objektiv und Stativ habe ich ja sowieso.
Anzumerken sei natürlich auch, dass das Abfotografieren (zunächst!) viel schneller geht: Das Scannen einer großen Vorlage dauert lange. Noch länger dauert es, wenn man den Multiscan hinzu schaltet und die automatische Staub- und Kratzerentfernung. Da kann es in der Summe durchaus schon pro Bild 20 Minuten dauern, bis fertig gescannt wurde! Allerdings braucht ein Stitchen von mehreren Einzelaufnahmen ebenfalls Zeit und bedeutet Aufwand bzw. eine gute Software und die manuelle Staubretusche ebenso. Zudem können Flachbettscanner viele Dias / Negative auf einmal digitalisieren – unbeaufsichtigt. Auf die automatische Staubentfernung kann man allerdings zum großen Teil verzichten, wenn man bereits beim Digitalisieren auf Staub achtet (und wieder etwas Zeit investiert).
Es hängt also sehr von den eigenen Voraussetzungen ab, ob lieber gescannt werden soll oder ob die Negative / Dias einfach von der Leuchtplatte abfotografiert werden sollen. Würde ich jede Woche Mittelformatnegative oder gar Großformat-Planfilme digitalisieren wollen, ich würde beim Scanner bleiben bzw. in so einen investierten. Denn beim Abfotografieren muss jedes Bild nacheinander einzeln ausgerichtet werden, zur Sicherheit sollte dann die Schärfe kontrolliert werden. Hat man keinen Auto-Zwischenring, muss hierfür jedes Mal die Blende geöffnet werden, bei Fokussieren über Live-View ebenso (zumindest bei meiner Nikon ist dies so). Möchte man die hohe Auflösung der Negative ausnutzen, muss man oft zwei versetzte Aufnahmen anfertigen und diese Aufnahmen zusammen führen (Stitching). Stimmt die Planparalleltität noch? Passt die Belichtungszeit? Ist es im Raum dunkel genug? An all dies muss man beim Scannen nicht denken: Hier legt man gleich mehrere Filmmotive ein, schließt den Deckel und lässt den Scanner machen (bei Flachbett-Scannern). Bei den teureren Epson-Scannern kann man z. B. mehrere Filmstreifen einlegen (18 Einzelbilder), den Deckel schließen und dann Kaffee trinken gehen. Dank Infrarot-Staubentfernung muss man hier noch nicht einmal penibel arbeiten. Für sehr hochwertige Scans muss man jedoch mehr beachten.
| | | | |
| Plustek OpticFilm 8200i SE 35mm Dia/Negativ Filmscanner (7200 dpi, USB) inkl. SilverFast SE | Epson Perfection V600 Photo Scanner | EPSON B11B224401 Perfection V850 Pro Scanner (Vorlagen, Dias und Filmnegative scannen) schwarz/silber | Rollei DF-S 180 Dia-Film-Scanner |
|
|
|
|
|
|
|
|
| € 345,41 | € 448,99 € 361,36 | € 1.297,99 € 940,99 | € 39,99 |
| |  |  | |
| auf büroshop24 ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Foto Erhardt ansehen |
Würde ich jedoch nur hin und wieder einige Negative digitalisieren wollen, so wäre mir der Aufwand mit dem Aufbau und ggf. Stitchen recht und ich würde auf einen Scanner verzichten. Würde ich dabei nicht auf absolute Planlage Wert legen, würde ich mir wahrscheinlich einfach solch ein System aus Makroschiene und Objektivvorsatz besorgen. Das reicht bereits aus für gute Ergebnisse. Ich selbst belichte vielleicht jeden zweiten Monat einen Film, von dem dann einige Aufnahmen digitalisiert werden. Mir reicht das Abfotografieren bzw. ich genüge mich mit dem Mehraufwand des Aufbaus und der Kontrolle. Allerdings schwöre ich auch auf die klassische Buchbildbühne mit Glaseinsätzen über der Leuchtplatte und nutze keine provisiorischen Filmhalter. Sehr gute Ergebnisse erhalte ich übrigens auch einfach mit Antireflex-Bilderrahmenglas auf der Leuchtplatte. Aber dies wird dann wieder fummeliger als in einer Buchbildbühne (Fingerabdrücke und Kratzer drohen).
Geht es jedoch weniger um Qualität (mit der Lupe betrachtet) sondern um Quantität (riesige Archive zu digitalisieren), dann stellen sich hierbei drei Fragen:
- Sind die vielen, vielen Vorlagen verschmutzt, dann würde ich scannen (automatische Retusche bzw. ICE Infrarot-Scan – funktioniert nur bei Farbfilmen!).
- Sollen viele Mittelformat- oder gar Großformatfilme in sehr hoher Auflösung digitalisiert werden? Dann würde ich auch scannen, denn ein Stitchen (Zusammen Setzen mehrerer versetzt abfotografierter Aufnahmen ist Arbeit).
- Sind die Vorlagen jedoch einigermaßen sauber, würde ich abfotografieren (viel, viel schneller). Gerahmte Farbdias in Magazinen kann man auch in Windeseile mittels einem umgerüsteten Diaprojektor abfotografieren. Negative muss man aber im Anschluss mit einer Bildbearbeitung umwandeln und anpassen – und dies bei jedem Bild einzeln. Die Software eines Scanners macht dies automatisch (allerdings oft unbefriedigend).
Bei einem späteren Retuschieren von vielen Aufnahmen zerkratzter und verstaubter Dias / Farbnegativen wird Ihnen am Ende jedoch ein langer Bart gewachsen sein und der Geschwindigkeitsvorteil wäre dahin. Spaß macht dies nicht. Wer mit Photoshop arbeitet, kann hierbei auf das (kostenpflichtige) Plugin „SRDx“ von LaserSoft greifen. Es erkennt und entfernt solche Störungen automatisch (versucht dies zumindest). Vielleicht gibt es hierzu auch günstige / kostenlose Alternativen.
Nicht nur für Privatnutzer gäbe es ggf. noch ein weiteres Problem bei der Nutzung eines speziellen Filmscanners: Was tun, wenn das Gerät plötzlich Streifen abbildet, seltsame Geräusche macht oder der Filmeinzug nicht mehr korrekt funktioniert? So etwas kann irgendwann durchaus bei den höher wertigen Gebrauchtgeräten (Coolscan, Flextight, Trommelscanner) auftauchen. Normalerweise müsste solch ein Gerät dann zum Service geschickt werden – Aber die Spezialisten sterben sozusagen aus oder sind zumindest in Rente. Ersatzteile wird es auch kaum noch geben. Bei der Verwendung einer Digitalkamera als Scanner kann man aber alle Komponenten selbst austauschen, da diese ja stets als Neuware zur Verfügung stehen. Irgendwann kann man dann auch ein Kamera-Update für eine noch höhere Auflösung machen, wenn es der Geldbeutel hergibt.

Ein Fuji Frontier SP-3000 Scanner. Das Foto stammt aus der Vorstellung vom Nimm Film Lab.
Wie machen es eigentlich die professionellen Anbieter wie Mein Film Lab oder Nimm Film? Diese nutzen zur Digitalisierung häufig den „Fuji Frontier“ Scanner, wenn beides versucht wird, mit einer Klappe zu schlagen: Qualität und Geschwindigkeit. Diese großen Geräte schaffen es tatsächlich, einen ganzen Film automatisch hurtig einzuziehen bei hoher Scan-Qualität bzw. Auflösung und besitzen außerdem eine Kratzer- und Staubentfernung mittels Infrarotscan (Digital ICE). Für die meisten Heimanwender dürfte solch ein Fujifilm Frontier allerdings keine Lösung sein (zu teuer, zu groß, technische Kenntnisse, Service?).
Am Ende sei natürlich auch in Frage gestellt, ob man denn diese hohe, mögliche Auflösung überhaupt benötigt: Fotografiere ich mit meiner Digitalkamera ein 6×6-Mittelformat-Negativ mit nur einer Aufnahme ab, erhalte ich eine (beschnittene) Auflösung von 4000 x 4000 Pixel (also 16 anstelle von 24 Megapixel). Diese wurde vor nicht langer Zeit noch als hoch eingestuft und damals wurden damit gute und große Ausstellungsdrucke angefertigt. Ich achte in diesem Artiel viel auf Zahlen. In der Praxis ist dies aber gar nicht so relevant.




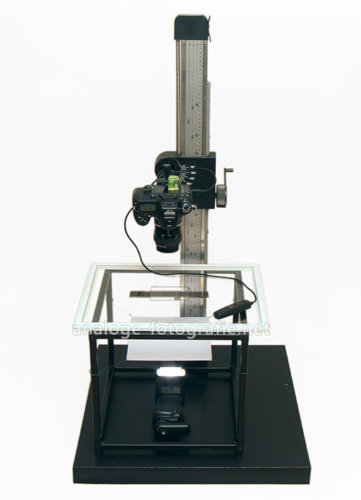



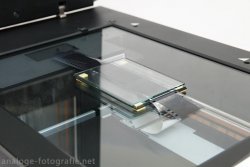
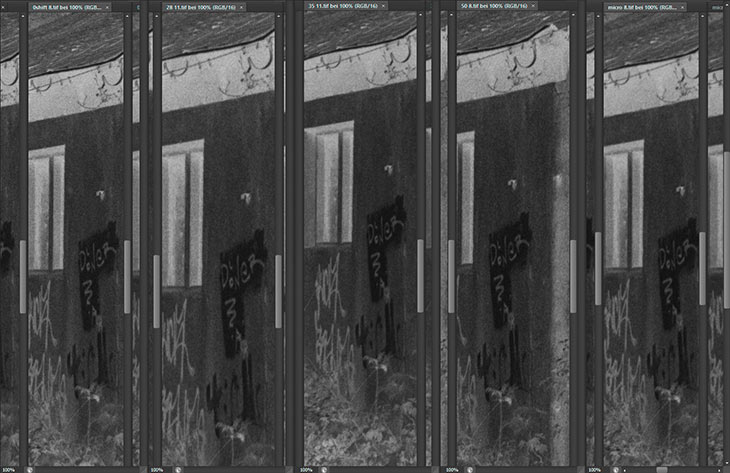
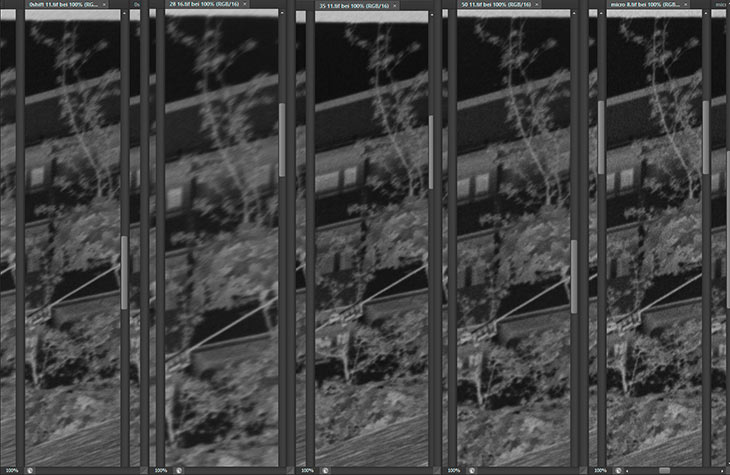



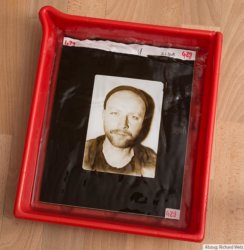






Hallo Thomas,
vielen Dank für deinen umfassenden Artikel.
Ich habe noch eine Frage zu APS-C Kameras mit Cropfaktor.
Wenn ich hier ein Vollformat-Makroobjektiv anschliesse erhalte ich bei maximaler Vergrößerung (1:1) nur einen Teilausschnitt des KB-Negatives. Um das ganze Negativ aufzunehmen muss ich die Kamera weiter weg bewegen. Damit verliere ich aber Details des Negatives.
Kann ich das mit einem Zwischenring ausgleichen, oder wird damit die Vergrößerung noch stärker und der Ausschnitt noch kleiner?
VG
Hallo Rudolf, wenn du nur ein Teil des Negativs im Sucher siehst und die Außenbereiche fehlen, musst du doch einfach nur die Kamera etwas höher positionieren, damit das gesamte Negativ ins Bildfeld gelangt. Wenn du vorher scharf stellen konntest, dann nun erst Recht. Einen Zwischenring benötigst du dann nicht. Da der Sensor der Kamera kleiner als das Negativ ist, kann so ja keine 1:1-Aufnahme vorgenommen werden. Ich nutze auch eine Digitalkamera mit kleineren Sensor. Ich benötige jedoch für mein Objektiv einen kleinen Zwischenring, um scharf stellen zu können, wenn das Negativ gerade so formatfüllend im Sucher erscheint.
Hallo Thomas,
nochmals danke für deine Bemühungen wegen meiner Glaseinlagen im Kaiser VarioCopy. Ich habe Kaiser jetzt mal per Mail angeschrieben und bin gespannt, was als Antwort kommt.
Ich hoffe, ich darf dich noch etwas fragen:
Da es mit meinen Glaseinlagen nicht funktioniert, habe ich meine ersten Negative mit den Kunststoffeinlagen für 35 mm Film abfotografiert. Damit bin ich allerdings nur mäßig zufrieden, weil die Maske darin doch sehr viel vom Bild auf den Negativen wegschneidet. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Maske etwas größer ist als 36 x 24 mm. Croppen kann ja später in Lightroom. Tatsächlich ist der Maskenausschnitt in den Einlagen bei mir nur 35 x 23 mm groß, obwohl 36 x 24 mm drauf steht. Das ist nicht nur ärgerlich wegen des Fehlens eines Teils des Bildes am Rand, sondern auch, weil das Seitenverhältnis anders ist. So muss ich die abfotografierten Negative dann nochmal etwas zuschneiden, wenn ich am Ende beim Seitenverhältnis 3:2 landen will. Weißt Du, warum der Ausschnitt der Plastikeinlagen so klein ist? Beträgt der Ausschnitt bei deinen Einlagen auch nur 35 x 23 mm? Nicht, dass ich bei den Plastikeinlagen auch eine fehlerhafte Charge bekommen habe.
Danke und Gruß
Christian
Hallo Christian, ja bei mir beträgt die Öffnung auch nur 35mm x 23mm. Das ist aber normal: Diese Masken wurden ja ursprünglich für das analoge Vergrößern bzw. für Vergrößerungsgeräte gebaut: Alle Standardmaß-Masken die ich kenne (unterschiedliche Hersteller) sind immer leicht kleiner als das eigentliche Negativformat, damit schräges Licht abgehalten wird und damit nicht aus Versehen ein dünner Spalt Licht mit einbelichtet wird.
Viele, die selber Vergrößern, feilen sich diese Masken etwas auf, um einen schwarzen Rand um das Motiv einzubelichten. Das Feilen ginge hier bei den Kaiser-Masken sicherlich besonders einfach, da sie aus Kunststoff sind.
Für mich ist das also normal, daher hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass diese Netto-Maße nicht den Brutto-Maßen auf dem Papier entsprechen. Ich denke, viele analoge Kameras belichten auch leicht anders in der Größe.
Hallo Thomas,
danke für deine schnelle Antwort. Die Kanten meiner Glaseinlagen sind abgeschrägt. Aber insbesondere im klappbaren Oberteil der Buchbildbühne ragen die beiden Plastiknasen deutlich (etwa 1 mm) über die Oberfläche des eingelegten Glases. Im Unterteil stehen die Nasen nur minimal über. Bei den Plastikmasken ist der Überstand der Plastiknasen nur minimal, aber dort kommt es ja nicht so darauf an
War dein Hinweis auf eine fehlerhafte Charge bezogen auf die Gläser oder auf die Buchbildbühne? Und wo hast Du es reklamiert? Beim Händler oder direkt bei Kaiser?
Gruß
Christian
Hallo Christian, ich füge dir mal eine Detailaufnahme der Kaiser-Vario-Copy Buchbildbühne an:

Bei mir ist das alles flach: Wenn ich die Buchbildbühne mit den Gläsern schließe, sehe ich von der Seite keinen Schlitz. Beim Öffnen gibt es einen leichten Widerstand, weil keine Luft zwischen den Flächen vorhanden ist.
Es klingt so, dass bei Dir etwas nicht richtig produziert ist. Bei mir waren es damals die Gläser. Ich hatte dann prompt Ersatz bekommen. Allerdings hatte ich damals direkten Kontakt zu einem Mitarbeiter von Kaiser, da ich meine Vario-Copy für einen Beitrag gesponsert bekam. Sind bei Dir nicht diese gelben Kärtchen dabei gewesen bezüglich Gewährleistung?
Hallo Thomas,
erst mal ein riesiges Dankeschön für diesen großartigen Beitrag! Ich habe gerade damit begonnen, meine Negative abzufotografieren und habe mir dazu das Kaiser FilmCopy Vario Kit 2458 gekauft. Um die optimale Planlage für bestmögliche Auflösung zu erreichen, bin ich deinem Rat gefolgt und habe mir gestern zusätzlich noch das Glaseinlagen Set AN-Glas/Klarglas von Kaiser geholt. Hierzu habe ich eine Frage:
Wenn ich die Glaseinlagen in die Buchbildbühne einsetze und diese zuklappe, dann liegen bei mir die Glaseinlagen nicht plan aufeinander. Der Negativstreifen hat zwischen den Gläsern deutliches Spiel, was ja dem Sinn der Glaseinlagen widerspricht. Dies scheint mir daran zu liegen, dass die beiden Laschen, die die Glaseinlagen in der Buchbildbühne fixieren, etwas höher stehen als die Glasoberfläche. Mache ich hier beim Einsetzen der Glaseinlagen etwas falsch?
Danke im Voraus für deine Antwort.
Gruß
Christian
Hallo Christian, es freut mich, dass ich schon etwas weiterhelfen konnte. Zu den Gläsern: Sind deine an den Kanten abgeschrägt? Sie müssen abgeschrägt sein. Kaiser hatte hier eine fehlerhafte Charge. Das weiß ich, weil ich anfangs selber betroffen war. Das wäre dann ein klarer Reklamierungsgrund.
Du hast ja sicherlich auch Plastikmasken dabei. An ihnen kannst du es vergleichen. Die beiden Laschen zum Fixieren dürfen, wie Du richtig annimmst, nicht abstehen.
Grüße
Thomas
Eine Frage an den Autor: Welches Nikkor Micro benutzt Du: 40 mm, 60, 105? Ich habe versucht, mit einer Fuji x100v meine Mittelformat-Negative (6×6 und 6×4,5) abzufotografieren. Ich kann zwar bis auf 10 cm rangehen, aber selbst dann wird die Sensorfläche nur halb ausgefüllt. Weil aber selbst diese Ergebnisse recht vielversprechend aussehen, würde ich es gerne mit Macroobjektiv versuchen, wie Du es beschreibst. Ansonsten: Super Seite und sehr hilfreich, dadurch bin erst draufgekommen, es mal auf diese Weise mit dem Digitalisieren von Negativen zu versuchen.
Hallo und danke für die Blumen! Ich benutze das „Nikkor 55mm 1:3.5“. Das ist ein Makro-Objektiv aus den 80ern oder noch früher. Ich nutze es an einer Crop-Digitalkamera und bekomme das Mittelformat problemlos formatfüllend abgebildet (ich kann das 6×6 so auch stitchen bzw. noch näher heran gehen). Nur beim Kleinbild komme ich nicht nah genug heran. Hier benötige ich einen ganz kurzen Zwischenring, um formatfüllend abbilden zu können. Das mache ich jetzt seit mehreren Jahren so und bin sehr zufrieden mit der Methode. Man muss halt nur immer auf- und abbauen und alles genau ausrichten.
Hallo Thomas,
auch von mir vielen Dank für die ausführlichen Tipps und Erfahrungsberichte, Deine und die der Kommentatoren!
Leider habe ich Deine Seite zu spät entdeckt, so dass der Link zu den Druckdaten für den tubusartigen EFH-Aufsatz nicht mehr funktioniert.
Gibt es einen Weg, auf dem ich die Druckdaten vielleicht doch noch erhalten kann?
Mit herzlichem Gruß!
Hallo Franz, danke für den Hinweis, dass der Link nicht mehr verfügbar ist. Darum muss ich mich kümmern. Ich hatte mir diese Druckdaten vorsichtshalber heruntergeladen. Schreibe mir dazu eine E-Mail (steht im Impressum), dann sende ich die Daten.
Viele Grüße zurück!
Hallo Thomas,
Lob und Anerkennung für Deine Fleißarbeit und vielen Dank für die vielen detailreichen Informationen: Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Aber Pedanterie ist für optimale Ergebnisse eine sehr positive Eigenschaft.
Ein großes Problem ist die geringe Schärfentiefe der Makroobjektive: Meine (glaslosen) Dias sind alle etwas gewölbt und ich kann nicht 15000 Dias alle aus den Rähmchen pullen, um sie unter Glas abzufotografieren. Wäre da nicht die Technik des Focus-Stackings eine Lösung, um die Schärfentiefe etwas zu vergrößern? Hast Du da Erfahrung drin?
Noch eine Anmerkung: Im Abschnitt „Schichtseite oder Trägerseite: Was zeigt zur Kamera?“ schreibst Du: „Richtig wäre, dass beim Abfotografieren von Film die rauhe ‚Trägerseite‘ hin zur Kamera zeigt.“ (fett gedruckt) Muss das nicht ‚Schichtseite‘ anstatt ‚Trägerseite‘ heißen? Überprüfe das mal.
Viele Grüße
Alfred
Hallo Alfred, herzlichen Dank für den Hinweis zu dem Absatz mit der Träger- bzw. Schichtseite. Ich hatte dies sogar bei dem Beispielbild vertauscht und dies dank Deinem Hinweis nun korrigiert.
Ich habe mit Focus-Stacking bei Makros (was das Abfotografieren von Dias ja technisch ist) leider keine Erfahrung. Aus der Lektüre weiß ich, dass diese Technik bei der Makrofotografie offenbar zielbringend angewendet wird, so dass dies hier (wenn man die Zeit und Geduld hat) sicherlich sinnvoll ist, zumindest bei wichtigen Motiven. Praktische Erfahrung habe ich selber hierin leider nicht. Es müsste dann irgendwie möglichst gut automatisiert ablaufen bzw. die Einzelbilder müssten automatisch logisch zusammen gesetzt werden können bei so vielen Dias. Aber woher weiß der Computer, was Unschärfe bei der Digitalisierung ist oder natürliche Unschärfe des Motivs? Das könnte schwierig werden und man müsste dann die Montagen manuell vornehmen.
Viele Grüße zurück!
Zur Antwort am 21.8.2022:
Buchbildbühne aus dem Vergrößerer. „Ich weiß jetzt nur nicht, ob die von Kaiser plan aufliegt. Aber so etwas kann man ja entsprechend modifizieren.“
Sie liegt nicht plan auf, weil sie unten abstehende Teile hat. Man kann sie auf 2 Bleistifte o.ä. legen, damit sie plan liegt, was aber eine etwas wackelige Sache ergibt, die man auch immer wieder kontrollieren muss. Eine Modifikation mit stabilem Resultat sollte so sein, dass man die Bühne immer noch im Vergrösserer verwenden kann. Die vom FilmCopy liegt plan und zerkratzt das Leuchtpult nicht.
PS: Wenn man die Vergrössererbühne für den Fotoscan nimmt, darf man nicht vergessen, die AN-/Plangläser jeweils entsprechend der Lichtrichtung zu tauschen. Leider habe ich diesen Punkt erst aufgrund dieses Artikels beachtet. Meine Fotos sind scharf, das Korn ist aber wenig sichtbar. (Eine Frage war oben zu sehr starkem Korn. Die Antwort war u.a. etwas Unschärfe. Eine einfache Variante könnte auch mein Fehler sein: absichtlich die Schichtseite durch das AN-Glas fotografieren, dann ist viel vom Korn beseitigt, die Schärfe leidet kaum.)
Ich habe die Produkte von Negative Supply entdeckt. Dort werden viele Hilfsmittel für den Fotoscan angeboten, die aber auch richtig Geld kosten können. Wer viel abfotografiert, wird sich freuen an den Filmtransporten mit dem Transportrad. Die Planlage ist kein Thema mehr. Man kann damit die günstige Kaiser Platte nehmen (was die Hersteller in einem Video auch tun), ausser man will CRI 99.
Vielen Dank für den Kommentar und für den Tipp zur AN-Scheibe bei absichtlich falschem Gebrauch! Das werde ich mal ausprobieren.
Hallo Thomas.
Ich hab 2011 angefangen mit der Filmfotografie, hatte die letzten Jahre aber etwas pausiert und erst kürzlich wieder angefangen. Nachdem ich meinen Filmscanner mittlerweile verkauft hatte, habe ich mich nun auf für‘s Kamera-Scannen entschieden, die Sony A7R2 mit einem 105mm Makro bietet da einiges. Einen Reproständer von Kaiser hatte ich noch. Also bestellte ich mir ein Leuchtpult und den EFH.
Aber ganz ehrlich: Alles was du oben beschreibst war mir viel zu viel Arbeit. Distanz, Platzierung, Streulichtvermeidung und vor allem Parallelität einzustellen ist echt viel Arbeit, ehe man das erste Negativ auf der Speicherkarte hat.
Wie gut, dass ich mir letztes Jahr auch einen 3D-Drucker gekauft und mich etwas ins 3D-Design eingearbeitet habe.
Nun habe ich einen Ständer gedruckt, den man auf den EHF aufsetzt und auf den man dann oben das Objektiv inklusive Gegenlichtblende aufsetzt. Damit ist sichergestellt, dass man immer exakt den zur Maske passenden Abstand eingestellt hat, Parallelität ist automatisch gegeben und der Strahlengang zwischen Film und Kamera ist komplett umschlossen, so dass auch Streulicht kein Thema mehr ist.
Das Ding besteht aus Basis, Zwischenring und Oberteil, der Zwischenring wird benötigt, um die verschiedenen Distanzen für 135 und 120 herzustellen.
https://up.picr.de/43523046ns.jpeg?rand=1677445289
Und aufgebaut sieht das dann so aus:
https://up.picr.de/43525425bj.jpeg?rand=1677445289
Seither werden Filme auch nicht mehr geschnitten. Wenn sie als 36-Bilderrolle in den EFH eingelegt werden, muss ich nur noch weiterziehen. Die Kamera wird über Tethering vom Computer aus direkt ausgelöst und legt das Bild in den Eingangsordner von Lightroom, Negative Lab Pro macht den Rest.
Seit ich den EHF mit meinem kleinen Ständer kombiniert hab, bin ich in der Lage, einen 36er-Film in unter 10 Minuten zu digitalisieren.
120-Filme, bei mir heißt das 6×6 (Hasselblad 501CM oder rolleiflex 3.5E) schieße ich mit der 645 Maske in zwei Bildern, wobei die 60mm des Bildes auf die 36 mm Kante des Sensors abgeglichen sind. Die Bilder werden dann in ebenso in Lightroom abgelegt, dort zusammengefügt und dann geht es wieder weiter mit Negative Lab Pro.
Falls andere EFH-Nutzer daran interesse haben: Ich hab den Kameraständer bei Thingsverse hochgeladen, wo er kostenfrei heruntergeladen und selber gedruckt werden kann. Dabei sind genügend Zwischenring- und Oberteil-Versionen, dass man für praktisch jedes Makro-Objektiv eine Lösung finden müsste.
Edit: Link zu den Druckdaten nicht mehr erreichbar.
Hallo Thorsten: Eine tolle Idee! Die Kamera via Verlängerung direkt auf einen Filmhalter zu platzieren, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich werde Deine Idee bald gleich in den Artikel mit aufnehmen (bin gerade kurz angebunden). Kann ich deine beiden Fotos dazu einbinden?
Die Druckdaten habe ich mir schon herunter geladen. Auch wenn ich keinen 3D-Drucker habe: So etwas sammele ich schon provisorisch.
Vielen Dank für diesen vortrefflichen Beitrag.
Aus Alt-Teilen habe ich mir eine Repro-Einrichtung für Dias und Filme gebaut: Als Basis habe ich eine Olympus Pen E-PL3 (12 Megapixel). Dazu habe ich mir ein Alt-Objektiv angepasst: Tarcus Macro mit C-Mount, mehr dazu in
https://www.systemkamera-forum.de/topic/134946-tarcus-objektiv/#comment-1899353.
Für den Dia-Transport verwendete ich einen Schieber aus einem alten Projektor, Als Diffusor-Scheibe ein Stück 0,8mm Teflon. Die Lichtquelle ist ein LED-Array 94x50mm (es hätte kleiner sein dürfen). Zur Abschattung verwendete ich Rohr-Stücke aus ausgedienten Dia-Duplikatoren. Unterschiedliche Rohr-Durchmesser habe ich durch eine dicke Lage von Polyimid-Klebstreifen angepasst. Die Kamera sitzt auf einem Makro-Schlitten, damit kann ich den Maßstab recht gut einstellen.
Dieser Beitrag war mir eine vortreffliche Hilfe mit diversen Details für die Reproduktion, die hier beschrieben sind.
Wolfgang
Hallo Wolfgang, danke für Ihren Kommentar bzw. für die Tipps und für das Lob. Freut mich!
Keine Ursache. Lob, wem Lob gebührt 🙂
Ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
Ich habe mich nun entschieden eine gebrauchte Originalbildbühne von Kaiser zu besorgen.
Und zwar mit einem Vergrößererkopf mit Halogenbirne und Reprostativ gleich mit dran 🙂
Ich bin bei kritischen Anwendungsfällen ein Fan von kontinuierlichem Lichtspektrum, nach dem schwarzen Strahler Prinzip.
Obwohl die High-CRI LEDs sicher deutlich besser sind als früher, was die Farben angeht, die für die CRI-Angabe genormt sind.
So können die Hersteller aber bei den anderen, Nichtnormfarben, etwas laxer sein, und übermässige Spikes und Valleys (im Vergleich zu Halogen) kann es dennoch geben.
Die Farbtemperatur ist meines Erachtens etwas weniger wichtig als die Kontinuität. Schlieslich geht es mir bei der analogen Fotografie auch um sanfte Übergänge in den Mitteltönen, die ich durch Digitalisieren möcghlichst wenig gefärden möchte.
Soweit zumindest meine Theorie :-).
Außerdem gibt es leichte Unterschiede zwischen verschiedenen LEDs auch innerhalb einer Charge, was man bei Benutzung nur einer Punktlichtquelle (Halogenbirne) vermeiden kann.
Viele Grüße
Michael
Hallo Thomas,
super Artikel.
Eine Frage: Worin genau unterscheidet sich denn die normale „System-V-Buchbildbühne“ von der, die beim FilmCopy Kit dabei ist?
Was ich sehen kann sind zwei Klemmklammern auf der Oberseite bei der normalen Bühne. Wie relevant ist das denn? Gibt es einen weiteren Unterschied?
Die normale „System-V-Buchbildbühne“ und die Masken nebst dem größeren Slimlite LED Panel ist sogar günstiger zu haben als das Kit, ohne die Matte für den Slimlite aber die möchte ich eh nicht (zuviel Kunstoff in die Welt gesetzt) sondern lieber schwarze Pappe selbst zugeschnitten.
Lieben Dank und Gruß
Michael
Hallo Michael, danke für das Lob!
Die Buchbildbühne im Filmcopy-Kit hat, wie bereits von Dir gesagt, die Klemmen nicht. Die werden hier auch nicht benötigt (sie dienen zum Fixieren in einem Foto-Vergrößerer, in den man sie einschiebt, falls du das nicht kennst). Meine hat aber unten einen recht schweren Metallrahmen mit Füßchen angeschraubt, wodurch sie sicher und gerade (planparallel) auf der Leuchtplatte steht. Hätte ich sie nicht, würde ich einfach irgend eine Buchbildbühne nehmen, für die ich auch noch brauchbare Masken finden würde und diese Bühne ggf. noch etwas modifizieren. Man kann also durchaus auch die Buchbildbühne aus dem Vergrößerer nehmen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die von Kaiser plan aufliegt. Aber so etwas kann man ja entsprechend modifizieren.
Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
Du bildest am Beginn des – sehr eindrucksvollen – Artikels Fotos eines Joachim Schlegel ab. Vielleicht ist der Herr mit Arthur Schlegel verwandt – einem früheren Leiter der legendären Münchner Fotoschule (seit 2002 in die Hochschule München integriert). Schlegel verkaufte im Jahr 1964 Aufnehmen aus der Münchner Residenz, gemacht 1935, an das Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte, darunter eine Aufnahme der sog. ‚Gelben Treppe‘ der Münchner Residenz, die im II.Weltkrieg und nachfolgender Verfallsphase zerstört wurde. In achtjähriger Arbeit haben wir – die Bauabteilung der Schlösserverwaltung, der ich angehöre – dieses Raumkunstwerk rekonstruiert, es steht kurz vor der Vollendung. Das erwähnte Foto Schlegels bildete dabei die ganz entscheidende Quelle für wichtige Teile dieser Rekonstruktion, etwa eines Prunkportals mit dem Wahlspruch König Ludwigs I. Die Bayerische Schlösserverwaltung, wie auch das Zentralinstitut, besitzen jeweils nur Abzüge des Bildes – und diese mit Schärfeproblemen. Für vertiefte Untersuchungen und auch eine Publikation des Themas wäre es natürlich höchst willkommen, auf das (Glasplatten-)Negativ des Bildes zuzugreifen, das sich im Nachlass Schlegel befinden muss. Diesen konnte bisher aber noch niemand ausfindig machen. Möglicherweise komme ich auf solch einem verschlugnenen Weg – oder Infos aus der ‚Szene‘ – auf die Spur der so wertvollen Bildquelle. Ich übermittle sie auch gerne, wenn’s hilft.
Pardon für den langen Sermon – doch ich greife hier, hoffentlich verständlich, nach jedem Strohhalm. Dank vorab für eine vielleicht mögliche Unterstützung!
Hermann
Hallo Hermann, ich kann Ihnen hier gerne eine Kontakt-Email-Adresse des Herrn zukommen lassen. Schreiben Sie mir hierzu einfach eine E-Mail. Meine Adresse finden Sie im Impressum.
Hallo Thomas,
schaue doch einmal hier
https://www.blende7.at/datenblaetter/b+wfilter/filterhandbuch.pdf
auf Seite 9 findest Du die Kodakbezeichnungen (in Klammern) der Blaufilter. Vielleicht hilft Dir das.
Auf Seite 41 findest Du eventuell die passenden Filter für Dein Problem. Wahrscheinlich gibt es diese nur noch gebraucht. Ich persönlich würde die originalen Wratten-Filter von Kodak vorziehen. Sie sind feiner abgestuft.
Danke, ziemlich interessantes Heft. Habe es einmal abgespeichert.
Hallo Thomas,
in diesen Beitrag schaue ich immer mal wieder rein.
Das mit dem Blaufilter war mir neu.
Vorab, wäre es nicht besser Du würdest die Filterdichten nach der Nomenklatur von Kodak benennen. So könnte man sich darunter etwas vorstellen. 80B ist klar (Kodak-Wratten-Filter; Halogenlicht auf Tageslichtfilm), aber für was benutzt man einen KB20-Filter?
Überhaupt Blaufilter: wäre ein Cyan-Filter nicht sinnvoller? Die Komplementärfarbe von Orange ist nicht Blau.
Ich gebe zu, ich habe vom Abfotografieren von Farbnegativfilm keine Ahnung. Niemals würde ich freiwillig einen Farbfilm in die Kamera spannen. Aber ich mache mir so meine Gedanken. Sollte ich falsch liegen lerne ich gerne dazu.
Wieso benutzt Du ein Filter vor dem Objektiv und färbst nicht das Licht ein? Irgendwie erscheint mir das sinnvoller. Ich würde unter die Buchbildbühne einfach eine cyanfarbene Filterfolie oder ein großes Glasfilter legen.
Weiter, wäre es nicht besser Du würdest (ohne Blaufilter) eine genormte Graukarte und einen ebenso genormten Farbkeil auf Deinen Buntfilm fotografieren und dieses Negativ dann genau ausmessen? Die Werte vom Farbkeil sind bekannt. Die Umwandlung und Korrektur sollten keine Probleme bereiten. Du nimmst als Meßpunkt direkt die Abbildung der Graukarte und nicht den Filmrand. Die ermittelten Korrekturwerte werden gespeichert und dann alles via Stapelverarbeitung o.ä. automatisch verarbeit.
Hallo Frau Müller,
mit den traditionellen Filterbezeichnungen kenne ich mich nicht aus. Ich habe hier einfach die Bezeichnungen angegeben, die auf den Filterfassungen stehen.
Ich hatte hier auch nur zwei Filter ausprobiert, weil ich keine anderen tauglichen besitze. Gerne hätte ich ansonsten natürlich noch mehr Vergleichsaufbauten vorgenommen. Die Sache mit einer blauen Folie als Filter hinter dem Film also vor der Leuchtplatte ist eine gute Idee. Ich möchte doch einmal die Augen nach so etwas aufhalten, um hier einen Vergleich zu machen.
Ich hatte mal etwas mit einer abfotografierten 24-Feld-Farbkarte herum gespielt bzw. von dieser in der Software des Herstellers ein Korrekturprofil für Adobe Camera Raw angefertigt. Das hatte jedoch alles nicht richtig funktioniert. Leider finde ich meine Unterlagen dazu nicht mehr. Die besten Ergebnisse (auch mit Stapel-Möglichkeit) hatte ich mit dem Photoshop-Plugin „Negmaster“ erreichen können. Seitdem bleibe ich dabei.
Hallo,
die Fa. Kienzle Phototechnik bietet noch AN Gläser an, z. B. für Durst Bildbühnen.
Danke für die umfangreichen Informationen!
Danke für den Tipp!
Mit dem Weißabgleich habe ich lange das gleiche Verfahren angewandt wie hier beschrieben. Ich bin dann aber dazu übergegangen, den gesuchten Grauwert aus den Negativen selber zu beziehen. Also das Grau aus einem Stein einer weisen Blume oder einer Wolke oder so ähnlich zu entnehmen und nicht dem Filmrand. Ist meines Erachtens für jeden einen Versuch wert. Mir persönlich haben die invertierten Negative dann besser gefallen. Aber das ist am Ende Geschmacksache und wie der Autor hier schon schreibt, es gießt da keinen 100 % richtigen Weg. Grüße und Danke für den Beitrag
Respekt, der Text hat teilweise Längen, wahrscheinlich war keine Zeit für eine kurze Version.
Hallo Thomas,
sehr schöner, interessanter und detailreicher Bericht. Hier mal meine Vorgehensweise: Da mein Coolscan IV von Nikon und auch externen Werkstätten nicht mehr repariert wird, bin ich auch auf das Abfotografieren umgestiegen. Canon 600D (auf Kreuzschlitten geschraubt)mit gebasteltem Zwischenringadapter und Nikkor 1,4/50mm, Dia- und Filmstreifenhalter vom kaputten Coolscan (auf einen Holzblock geschraubt), Lichtschacht eines alten Durst Vergrößerers, und LED Klemmleuchte vom Lebensmittelmarkt. Die Schärfe wird bei f 1,4 eingestelt und dann auf Arbeitsblende 5,6 geschlossen. Kamera auf LiveView und Zeitautomatik. Ausgelöst wird per Kabel oder je nach Lust und Laune auch mal am PC. Als Software nutze ich DxO mit selbsterstelltem Preset für die Farbnegative, da werden pro Arbeitsgang ca. 100 Bilder eingestellt, markiert und das Preset angeklickt, … nach ca. 10 Minuten kann ich dann mit der Feinarbeit beginnen, – für die Entwicklung wähle ich tiff und jpg.
LG Walter
Hallo Walter, danke für den Einblick! Ich nehme an, du fotografierst dann horizontal aufgebaut ab. „DxO“ kannte ich noch gar nicht.
Viele Grüße zurück!
Hallo Thomas, das ist wirklich eine exzellente Seite, auf der unheimlich viel Wissenswertes steht. Ich habe auch schon ein wenig herumexperimentiert mit dem Abfotografieren von Dias mit Stativ und Leuchtplatte. Habe eine Nikon D750, die ich dazu nutze. Und aufnehmen tue ich tatsächlich im Raw-Format. In Deinem Beitrag schreibst Du einen Abschnitt zu Histogrammen. Wenn ich meine Kaiser-Leuchtplatte mit der Nikon Einstellung A (Zeitautomatik) fotografiere, dann ist mein Histogramm viel weiter in der Mitte als bei Dir. Und Du sagst nun: „Allerdings belichte ich im RAW-Modus eher nach rechts“. Demzufolge müsste ich (wenn ich die Blende nicht ändern möchte) einfach mit der Belichtungskorrektur und den bis maximal 4 oder 5 möglichen ganzen Blendenstufen arbeiten, umd das Gebirge nach rechts zu bringen? Dann habe ich überbelichtete Bilder, die ich dann in einem Bildbearbeitungsprogramm wieder auf einen normalen Wert zurückbringen kann (weiss noch nicht, ob das das Irfanview schafft, das GIMP vielleicht eher)….aber ich hätte den maximal möglichen Kontrast erhalten. Habe ich das so richtig verstanden? Oder wie bringst Du sonst das Gebirge nach rechts?
Habe sehr viele Kodachrome 64 Dias. Die werden zunächst mal sehr blaustichig, wenn man sie abfotografiert. Klar, auch das kann man in einem Bildbearbeitungsprogramm wieder zurückfahren. Noch besser wäre es freilich, man könnte dem gleich mit einer Einstellung an der Kamera selbst während des Abfotografierens vorbeugen. Weisst Du, ob es da einen Trick gibt? Vielen Dank jetzt schon mal :-). Gruss, Ralf
Hallo Ralf, bei der Technik „nach Rechts belichten“ muss man die Ergebnisse immer in einem „RAW-Entwickler“ laden bzw. in einem solchen Programm öffnen. Dort wird dann zurück „nach Links entwickelt“, indem einfach der Belichtungs-Schieber dort nach links bewegt wird. Dabei verspreche ich mir weniger Rauschen. Ich nutze hier Photoshop.
Programme wie IrfanView oder Gimp besitzen, meines Wissens nach, kein RAW-Entwickler-Modul. Diese Angelegenheit (das „nach Rechts belichten“) ist allerdings nicht so wichtig sondern eher etwas, was man machen kann, wenn man alles andere schon zur Perfektion gebracht hat. Falls hier Unklarheit herrscht, würde ich einfach weiterhin regulär belichten.
Bei einigen Kameras kann man während der Aufnahme bereits einen Weißabgleich nach Kelvin-Werten einstellen. Man könnte bei deinen Kodachrome-Filmen einen bestimmten Kelvin-Wert eruieren und diesen im manuellen Weißabgleich-Menü eintragen. Dann muss man später nicht mehr beim RAW-Konverter mit dem Weißabgleich Herumspielen. Leider habe ich mit Kodachrome gar keine Erfahrung. Meine Erfahrung allgemein: Bei der analogen Farbfotografie muss man oft jedes Bild manuell nach Auge ausfiltern, wenn man perfekte Farben haben möchte. Rein automatisch konnte ich hier (ob Scanner oder Abfotografieren) noch nie befriedigend arbeiten.
Viele Grüße zurück!
Hallo Thomas,
wow, seit meinem letzten Besuch auf der Seite hat sich einiges getan. Ich bin beeindruckt.
Als Praktikerin möchte ich einige kleine Anregung weitergeben um Dir das Leben zu vereinfachen.
Mein Tipp mit dem direkten Kontakt zum Computer scheinst Du inzwischen aufgegriffen zu haben. Wenn Du jetzt noch das alte (manuelle) Makroobjektiv gegen ein moderneres mit Autofokus ersetzt dann wird das Leben noch bequemer.
Der ideale Aufbau für mich (Repros vom Kleinbild) ist eine Reprosäule, die Digitalkamera (APS-C mit 12 MP), Makroobjektiv mit AF (bis 1:1) und ein schwarzer Karton auf der Kamera.
Wie Du schon selbst sagst benötigt man keine höhere Auflösung der Kamera. Das produziert nur unnötig große Dateien. Meist lasse ich sogar um das Negativ noch einen winzigen Rand.
Das (moderne) Makroobjektiv mit AF erleichtert die Arbeit weil man es am Computer einstellen kann. Man muß weder Kamera noch Reprosäule anfassen. Übrigens: mein Makroobjektiv ist auf große Entfernungen viel besser als im Nahbereich. Deshalb bevorzuge ich auch die APS-C-Kamera. So komme ich um den für mich suboptimalen Einstellbereich um 1:1 herum.
Ob ein Makroobjektiv im Bereich der Normalbrennweite oder länger besser ist weiß ich nicht. Persönlich bevorzuge ich die längere Variante. So stoße ich weniger mit dem Kopf gegen die Kamera wenn ich die Vorlage wechsele. Das ist wahrscheinlich aber eher Geschmackssache. Daß meine Arme zu kurz sind um gleichzeitig durch den Sucher zu schauen und die Vorlage zu bewegen ist unbedeutend. Ich benutze ja den Sucher oder das Display der Kamera nicht.
Reflexe vermeide ich indem ich einfach einen schwarzen Karton auf die Kamera lege. So kann man bequem bei Raumlicht seine Repros machen. Ach ja, ich benutze ausschließlich die Zeitautomatik. Meist zusätzlich die automatische Scharfeinstellung. In 90 % findet sie genügend Kontrast in den Negativen daß es klappt. Ob es paßt sehe ich ja am Computer. Im Zweifelsfall korrigiere ich.
Mit dieser einfachen und verhältnismäßig preiswerten Ausrüstung läßt sich flott fotografieren und die Ergebnisse können auch höhere Anforderungen befriedigen.
Ach ja, bei meiner benutzen Nikon (vor 2010 gebaut) funktioniert die Live-View-Funktion mit uralten Automatikzwischenringen (ca. 30 Jahre) wunderbar; zumindest mit dem alten AF-(Makro)Objektiv (noch ohne D).
Prima! Danke für deine Tipps. Ein modernes Autofokus-Makro wäre sicherlich bequem. Nachdem bei mir alles eingerichtet ist, bleibt der Abstand der Elemente, dank schwerer Buchbildbühne und stablier Konstruktion, immer gleich. Zwar bin ich ängstlich und kontrolliere dies hin und wieder nach jedem sechsten Bild. Aber bisher blieb es bei einer (manuellen) Einstellung. Das viele Geld für ein anderes Objektiv spare ich mir bei meinem geringen Durchsatz lieber, wobei mich ein Qualitätsvergleich natürlich dennoch interessieren würde. Nur die Sache, dass ich für das „Liveview“ immer die Blende öffnen muss, nervt etwas. Aber dies geschieht, wie gesagt, ja nicht bei jedem Bild.
Hallo Thomas,
meine Hochachtung für die detailreiche Arbeit und den Artikel darüber!
Bei meinen Digitalisierungsversuchen gab es immer deutliche schwächere Ergebnisse im Vergleich zum Labor-Scan. Ich benutze auch eine Nikon Kamera. Was mich bei meine Versuchen vorallem gewundert hat ist, dass die schlechtesten Ergebnisse bei der Umwandlung von Negativen mit Nikon NX Studio heraus kamen (im Vergleich zu anderen Programmen). Ich hätte erwartet, dass mit der hauseigenen Software am meisten aus einem NEF (Nikon RAW) heraus geholt werden kann. Aber hier schien das Problem „Blaufilter“ so stark zuzuschlagen, dass es nicht korrigiert werden konnte. Das kann natürlich auch an meinem übersichtlichen Anwenderfähigkeiten liegen. Gibt es andere Erfahrungen mit NX Studio?
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian
Hallo Sebastian, danke für das Lob! Tatsächlich habe ich nie mit dem Nikon-RAW-Entwickler gearbeitet. Ich übergebe die Dateien immer gleich Photoshop bzw. an dessen internen RAW-Konverter.
Anfangs dachte ich auch, man braucht nichts weiter. Aber wie es nun so ist: Jetzt sind Negative aufgetaucht, bei denen die Farbausfilterung wieder komplizierter ist und nicht so ohne Weiteres via RAW-Konverter konvertiert werden können. Wichtig ist nur das RAW-Format (kein Tiff, kein JPG) und am besten geht es meiner jetzigen Erkenntnis nach dann mit einem speziellen Addon (NegMaster, Negative Lab Pro, ColorPerfect, …). Leider braucht man bei allen dann wiederum ein Adobe-Produkt. Aber ich bin hier auch noch nicht fertig mit dem Nachforschen. Vielleicht eignet sich auch VueScan gut. Hier kann man ja auch Dateien laden. Ich habe auch noch nicht das perfekte Mittel gefunden.
Viele Grüße zurück!
Interessane und informative Webseite, die mir viele Infos auf meine Fragen in kurzer Zeit geliefert hat. Vielen Dank dafür!
Vielen dank für den informativen Beitrag. 35mm mit Nikon 55mm Micro und Zwischenring PK-12 funktioniert hervorragend. Hatte aber Probleme bei den 6×6 Negativen zu fokussieren. Muss ich den Zwischenring entfernen?
Hallo Lukas, bei 6×6-Vorlagen benötigt man bei diesem Objektiv keine Zwischenringe. Hier muss man sie vermutlich auch wieder abnehmen, damit man fokussieren kann. Das ist ganz normal.
Hallo Thomas und alle,
Super Seite, dafür erst mal herzlichen Dank!!
Eine Anmerkung, bzw. Tipp zum Invertieren des abfotografierten Negativs, egal ob s/w oder Farbe:
Ich nutze als RAW-Konverter, sprich Bildbearbeitungssoftware Darktable (www.Darktable.org), weil
es umsonst ist
für alle relevanten Betriebssysteme verfügbar (wird unter Linux entwickelt, aber auch Version für Windows und Mac)
es ist Open Source
Und es gibt ein Modul namens „negadoctor“ das mit einem Klick auf „Farbe“ bzw. „S/W“ mein Negativ schon mal ganz gut invertiert
Dann folgen noch Feinarbeiten mit dem Belichtungsmodul und Farbkalibration, oder was man auch immer ändern möchte.
Tolle Sache.
Das geht ziemlich schnell und ist eben keine Abosoftware, sondern Open-Source und umsonst. Nachteil ist eine ziemlich flache Lernkurve, d.h man muss sich mit den Möglichkeiten und der Bedienung auseinandersetzen (Manual lesen!). Bruce Williams hat auf YouTube inzwischen etwa 80 Erklär-Videos zu jeweils einem Modul von Darktable aufgenommen, erklärt jeweils ein Modul prima (auf Englisch).
Das ist alles vergleichsweise zeitaufwändig, aber die Ergebnisse rechtfertigen den Aufwand. Und wenn man erst mal diese Zeit investiert hat, dauert es meist 2 Minuten, bis das Bild (Negativ) fertig ist – es sei denn man hat ein „blödes“ Negativ;-).
Dies als Tipp für die, die einem Abomodell eher skeptisch gegenüber stehen.
Henning
Hallo Henning, danke für deinen Tipp!
Guter, vielleicht manchmal ZU ausführlicher Artikel.
Meine Vorrichtung mit guten Ergebnissen:
Pentacon Reproständer (präzise Feinverstellung), Leuchtplatte Soligor SV-310 Prof., Digitalkamera Canon EOS 5D Mark II, Makroobjektiv Voigtländer APO-Lanthar 2.5/125 mm,
Bildbearbeitung Lightroom oder Capture 1.
Ergebnisse halten jeden Vergleich mit guten Scannern aus.Vergleichbar mit TIFF’s aus einem Scanner mit 60 MB bei einer Firma in den USA.
Ja, bei gutem Objektiv (für Nahaufnahmen berechnet) und planparalleler, genauer Ausrichtung des Filmes erhält man mit der Digitalkamera Dateien wie aus einem guten Scanner. Ich hätte dies damals so auch nicht gedacht.
Hallo Thomas,
ganz herzlichen Dank für die ausführlichen Beschreibungen. Das ist das mit Abstand Beste, was ich je zu dem Thema gelesen habe.
Ich fotografiere ebenfalls gerne analog und digitalisiere mit DLSR (Nikon D850) und 60mm Makro. Für Kleinbild verwende ich den Nikon ES-2 Kopiervorsatz. Das klappt wunderbar. Für Mittelformat (6×6 Filmstreifen) nutze ich einen vertikalen Aufbau mit Stativ und Lomography Digitalizer auf Dörr Leuchtplatte. Mir ist aber auch bereits aufgefallen, dass sich damit keine 100% Planlage der Filmstreifen erreichen lassen.
Ich würde daher gerne in die von Dir angesprochene Kaiser Buchbildbühne investieren. Da ich eine Leuchtplatte schon habe, bräuchte ich dann vermutlich für 6×6:
2457: FilmCopy Vario
4485: Formatmasken 6 x 6 cm
4433: AN-Glas/Planglas (ist aber 6 x 9 cm)
Ist das richtig? Ich werde aus den Angaben auf der Kaiser Homepage nicht ganz schlau.
Mit Dank und Gruß
Markus
Hallo Markus, du bräuchtest hier als erstes die „Buchbildbühne“ bzw. „2457 FilmCopy Vario“. Bei diesem Set ist eine etwas modifizierte System-V-Buchbildbühne dabei, die Matte und zwei Maskenversionen fürs Kleinbild (Negativ und Dia). Man kann aber auch einfach die normale „System-V-Buchbildbühne“ nutzen. Die ist sicher etwas günstiger.
Für das 6×6-Format würde ich zusätzlich das Maskenpaar „4434 Anti-Newton-Glas/Maske, 6 x 6 cm“ empfehlen. Dieses besteht aus der Aninewton-Glasmaske sowie aus einer glaslosen 6×6-Maske. Oder du nutzt einfach das simple Maskenpaar 6×6 glaslos. Mit Glas ist halt eine bessere Planlage theoretisch möglich.
Ich selbst habe das Maskenpaar „4433 Glaseinlagen, AN-Glas/Planglas 6 x 9 cm“. Das sind zwei Glasmasken bis 6×9. Hier passen alle Filmgrößen rein bis eben 6×9 (eher 6×8). Der einzige Nachteil gegenüber Glaslos-Masken: Etwas mehr Staub, der entfernt werden muss. Man muss bei Glasmasken eben mehr penibel sein. Dafür ist die Planlage perfekt. Es gibt aber Filme, die sind auf der Schichtseite ebenfalls sehr glatt (z. B. Kodak Portra). Hier braucht man wieder eine Glaslosmaske (AN-Glas + Glaslosmaske).
Ich nutze immer das AN-Glas und bei Filmen mit matter Schichtseite (die meisten) das dazugehörige Klarglas (= perfekte Planlage aber mehr Staubwischen). Bei sehr glatten Filmen (Portra) muss ich anstelle des Klarglases eine 6×6-Maske nehmen (also AN-Glas + Maske). Diese Filme wölbe ich vorher künstlich, dass die Trägerseite zum AN-Glas zeigt und dieses den Film plan mit der Schichtseite auf die Glaslosmaske drückt. Das ganze wird stets so eingelegt, dass die Schichtseite immer nach oben zum Objektiv schaut.
Alles etwas verwirrend, doch ich hoffe, ich konnte da etwas weiter helfen.
Hallo Thomas,
nachdem ich Deinen Artikel gefunden habe sind mir meine alten DIAs von meinem 98er USA Aufenthalt eingefallen. Die wurden damals mit einer Nikon F801s und leider auf Fuji Film fotografiert. Egal..die Kaiser Leuchtplatte bestellt, und mit meiner Olympus OMD und 30 sowie 60 mm Macro einen Testaufbau erstellt. Leider sind die Ergebnisse nicht so geworden, obwohl ich wirklich jeden Deiner Ratschläge beherzigt habe. Bei mir sehen die abfotografierten Dias alle ein wenig krisselig aus. Keine Ahnung ob das mit dem Filmmaterial oder ???? zu tun hat. Ist es bei schlechtem Filmmaterial evtl. besser eine normale Festbrennweite zu verwenden um nicht jedes Filmkorn zu sehen?
Bin schon gespannt ob Dir vielleicht noch was einfällt was ich evtl. verbessern kann.
Viele Grüße
Hallo Günter, das klingt zunächst einmal danach, dass hier exakt und scharf auf das fotografische Korn fokussiert wurde. Warum dieses störend wirkt, kann ich allerdings nicht sagen. Vermutlich liegt es dann am Filmmaterial. Anstatt nun ein leistungsschwächeres Objektiv zu nutzen, kann man in einer Bildbearbeitung eine „Glättung“ (Weichzeichnen, Rauschen entfernen, etc.) vornehmen. Hier würde ich einmal diverse Möglichkeiten vergleichen, welche sinnvoll ist bzw. die Bilder gleichzeitig nicht unscharf erscheinen lässt. Oder aber irgendwo in der Verarbeitungskette ist ein „Scharfzeichner“ oder ähnliches aktiviert.
Viele Grüße zurück!
Hallo Thomas,
sehr beeindruckt von deinen Beiträgen, die mir sehr geholfen haben und immer noch helfen, wollte ich dir ein „Filmspende“ zukommen lassen. De PayPal Button bringt mich zwar auf die PayPal Platform, aber eine Adresse für deinen Account finde ich nicht.
Gruß Herbert
Hallo Herbert, bisher funktionierte dies. Aber ich muss es mir noch einmal genauer ansehen bzw. testen. Vielen Dank trotzdem!
Hallo Thomas,
vielen Dank für die nützlichen Tipps.
Ich verwende einen Kaiser Reproständer RS1, eine Canon EOS 6D Vollformat.
Als Objektive habe ich ein Canon EF 1:1.8 50mm, ASAHI SMC Takumar 1:1.4 50mm M42, Auto mamiya/sekor 1:1.4 55mm M42, Fujinon 1:1.8 55mm, Rodenstock Trinar 1:3.5 50mm und diverse andere ausprobiert. Mit den Ergebnissen wahr ich nicht so zufrieden. Vor allem am Rand sind die fertigen Bilder unscharf. Auch meine alte Canon EOS 40D APS-C Kamera liefert keine besseren Ergebnisse.
Kannst du mir ein Gutes Makro Objektiv für Canon empfehlen das vergleichbar mit dem „Ai Micro Nikkor 55mm 1:3.5“ ist.
P.S.: Ich mache Vorwiegend Aufnahmen von 24x36mm Negativen und ab und zu mal von Dias.
LG Oskar
Hallo Oskar, hier habe ich bisher nur Erfahrung mit meinem alten Nikkor (das einzige Makroobjektiv, das ich bisher nutzte). Vermutlich wird jede Makro-Festbrennweite im sehr nahen Nahbereich besser sein als deine anderen „normalen“ Objektive. Sicherlich gibt es für Canon auch gute, alte FD-Makro-Objektive, die man an EOS adaptieren kann. Da mein Nikkor nicht auf einen Abbildungsmaßstab von 1:1 kommt (Abbildungsmaßstab ist max. 1:2), brauche ich fürs Kleinbild noch einen kurzen Zwischenring. Daran muss man beim Kauf auch denken.
Viele Grüße zurück!
Servus Thomas,
vielen Dank für deinen extrem ausführlich Ratgeber. Bislang habe ich eher improvisiert meine 35mm-Negative digitalisiert und habe vieles aus deinem reichen Erfahrungsschatz als Anlass zur hoffentlich Verbesserung meiner Ergebnisse genommen!
Eine Anmerkung zur verwendbaren Software hätte ich noch: ich nutze seit Jahren Darktable als LR-Ersatz und das ist für mich mehr als ausreichend – ich kann jedem diese kostenlose (!) OpenSource-Software nur wärmstens empfehlen, nach einer gewissen Einarbeitungszeit möchte man das Programm nicht mehr missen.
Ab der aktuellen Version 3 (bzw. sicher ab 3.2.1) enthält Darktable auch ein Module namens „NegaDoctor“, welches unglaublich mächtig ist und mit dem ich sehr gute Ergebnisse erziele – allerdings mit hohem Zeitaufwand, da die Reproduktionsrate pro Foto doch überschaubar ist und – wie du schon sagst – jedes Foto seine eigenen Zuwendung benötigt, das Modul bietet einem schon beinahe zuviele Korrekturmöglichkeiten und ich empfehle dringend die entsprechende Dokumentation hierfür, z.B. unter: darktable-3-2/. Dort ist der Unterpunkt „NegaDoctor“ ausführlich erläutert (nach unten scrollen), es gibt auch eine deutsche Übersetzung davon. Die Umwandlung von (Farb-)Negativen funktioniert aber seither um Welten besser als mit dem vormaligen Modul „Invertieren“, das wirklich in keinster Art und Weise zu gebrauchen war.
Viele Grüße!
Matthias
Hallo Matthias, danke für den Einwand! „Einwand“ deswegen, weil ich Darktable selbst einmal ausprobierte aber damit nicht zurecht kam. Allerdings hatte ich das Modul „NegaDoctor“ gar nicht benutzt (bzw. wusste nichts davon). Das schaue ich mir zeitnah also noch einmal genauer an!
Grüezi Thomas
Ich habe deinen Artikel vor ein paar Stunden entdeckt und war überrascht wie viel Herzblut darin steckt. Werde einige Tipps von Dir ausprobieren. Ich habe mir die Multiblitz-Einrichtung zum Dias kopieren als Vorlage für mein Kopiersystem genommen, das besteht aus einem umgebauten Durst Vergrösserer zum Reproständer schon in der analogen Zeit als es noch keine Scanner gab und eine selbstgebaute Blitzbox damit ich die Negative/Dias mit den original Masken von Multiblitz verwenden kann. In die Blitzbox habe ich eine LED-Lampe zum Einstellen eingebaut (wie bei Multiblitz) als Hauptlicht ein Nikon-Blitz TTL über Kabel gesteuert damit habe ich meine vielen Dias kopiert.
Nun werde ich mich mit deinen Tipps an die Negative machen, von denen es einige Ordner voll gibt.
Mach weiter so und vielen Dank für die Arbeit
Werner
Hallo Werner, vielen Dank für den Kommentar! Deine Eigenbau-Vorrichtung klingt ebenfalls sehr interessant!
Hallo Thomas, alle Achtung zu diesem Artikel.
Ich beschäftige mich mit dem Thema seit ca. drei Jahren, habe einiges Ausprobiert, einiges an Geld ausgegeben. Allerdings nicht in dieser Tiefe wie Du. Im Nachhinein gesehen, hätte ich mir für das Geld einen sehr guten Scanner kaufen können. Da hätte ich aber nicht so viel Spaß gehabt uns nicht so viel gelernt.
Ich benutze eine Canon EOS 6D mit einem Sigma 50 mm F2,8 EX DG Makro-Objektiv. In 6D ist die Magic Lantern installiert, damit kann ich unter Anderem im Live View auf extrem ETTR achten.
Die Kamera ist auf einem alten Hama Reprostand montiert. Fokussieren mit Hilfe der Vergrößerung in Live View und durch die Kamera rauf und runter fahren. Objektiv ist immer auf 100% -> 1:1.
Als Lichtquelle und Filmhalterung bin ich nach einer langen Suche / Ausprobieren bei der Skier Copy Box gelandet, die Du in deinem Artikel auch erwähnst. Habe sie direkt in Taiwan im Juli 2019 für 179 USD bestellt. Für die Zollabfertigung kamen ca. 30 EUR dazu. Die Lieferung hat zwei bis drei Wochen gedauert. Die ganze Abwicklung ging sehr professionell ab.
Habe gemerkt das bei extremen Bedingungen die LEDs in der Leuchtplatte der Box sichtbar wurden. Durch folgendes ausprobieren. Die eingeschaltete nackte (ohne Film) Leuchtplatte mit ETTR abfotografiert. Das Bild in LR genommen den Dehaze Regler ganz nach rechts gezogen. So wurden (neben den ganzen Dreck auf dem Sensor :-)) die Positionen der LEDs sehr deutlich sichtbar. Das hat im „Alltag“ selten gestört, dennoch habe ich es Skier gemeldet. Anfang Oktober 2019 bekam ich die E-Mail, dass Skier die Diffusion Platte ausgetauscht hat und das sie mir die Skier Copy Box II kostenlos zusenden werden. Die kam dann auch ca. 2 Wochen später. Habe die oben beschriebene Testprozedur wiederholt – die Situation hat sich dramatisch verbessert.
Skier Copy Box hat wie du schon erwähnt hast keine Gläser, der Film hängt so zu sagen in der Luft. Bei 35 mm sehe ich es nicht als Problem, da mit Blende 11 der Schärfebereich bei 17 cm Entfernung Film – Sensor bei plus/minus 2,5 mm liegt. Bisher habe ich keinen 35 mm Film gehabt der so viel „gehangen“ hat.
Bei 120 mm sieht die Sache eventuell anders aus. Allerdings hat der 120 mm Filmhalter im Epson V750 Scanner auch nur die Stege zwischen den einzelnen Bildern. Dies entspricht in Etwa der Situation in der Skier Copy Box, wo nur ein Bild im Sichtbereich ist – hängen kann. Dennoch überlege ich ob ich ein passendes Stück Glass unter der Skier 120 mm Film Halterung befestige damit nichts hängen kann. Die Größe soll 7*7 cm sein. Es gibt viele Stellen in Internet wo man „Glass“ bestellen kann, bin aber nicht sicher wonach ich suchen muss.
Eventuell könntest du mir einen Rat geben, wo (und was) ich es finden kann. Glass schneiden kann ich selbst, habe bei meinen unzähligen Versuchen gelernt.
Bei 120 mm Filmen mache ich auch mehrere Fotos, die ich dann in LR oder PS mittels Panorama Funktion zusammenklebe. Am Anfang waren es sechs Fotos für ein 6*6 Negativ. Mittlerweile bin ich so wie Du bei 2 Fotos. Der Aufwand ist ansonsten zu groß, ich brauche die riesige Auflösung nicht.
Mit der Konvertierung der Negative habe ich einiges versucht. Am Ende habe ich mich mit dem ColorPerfect Plug-in für Photoshop angefreundet. Die Software ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, liefert aber sehr gute Ergebnisse und ist schnell.
Ja, der Staub. Am Anfang habe ich mich gefreut, dass ich den digitalen Sensor nicht mehr putzen muss. Für jedes Foto habe ich einen eigenen neuen chemischen Sensor. Und jeder von denen verstaubt vor sich hin. Habe von der Zeitschrift C’t einen Artikel gelesen in dem Beschrieben ist wie man die Infrarot Stauberkennung und anschließende Entfernung beim Abfotografieren / PS basteln kann, das war mir dann doch zu kompliziert.
Mittlerweile entwickle ich alle Filmarten selbst, SW, C41 und E6. Zurzeit bin ich auf einem Kodak Ektachrome Trip, die Farben sind umwerfend und die Konvertierung entfällt. Da ich noch einen Diaprojektor habe, kann ich die Leute mit Diaabenden quälen. Die Dias bleiben. Manchmal digitalisiere ich sie gar nicht mehr.
Einen praktischen Tipp habe ich von Dir mitgenommen. Den Spiegel Trick. Habe immer überlegt, wie ich wohl den Kamera Sensor parallel zum Film bekomme. Mit der Wasserwage ging es nicht das zu ungenau.
Vielen Dank und Gruß, Goran
Hallo Goran, danke für deinen ausführlichen Beitrag!
Wenn du die Planlage mit Glas verbessern möchtest (falls verbesserungswürdig), brauchst du beim Abfotografieren Glas mit geätzter Oberfläche, wenn eine Glasfläche auf der glatten Seite des Films aufliegt. Hier würde ich bei Ebay nach „Anti-Newtonglas“ (AN-Glas) schauen. Eine Alternative hierzu wäre raues Rahmenglas. Darüber hatte ich einmal einen Artikel geschrieben bzw. dieses mit AN-Glas verglichen.
Für die raue Schichtseite des Filmes ist ein hochwertiges, klares Rahmenglas eine gute Wahl. Eventuell kombinierst du einfach auch den originalen Rahmen der Skier Box mit einer Glasfläche. Der Film muss eine Wölbung in Richtung Glas aufweisen. Dann wird er durch dieses plan auf den Rahmen (oder auf das andere Glas) gedrückt.
Durch das geätzte Glas sollte man aber nicht hindurch fotografieren. D. h. es muss immer unten liegen und entsprechend zeigt der Film mit der glatten Trägerseite auch nach unten (wenn das Aufnahmeobjektiv oben ist).
Wenn man beim Abfotografieren meist ohnehin auf einen abgedunkelten Raum achten muss, dann erst Recht bei einer Glasfläche oben. Diese spiegelt die Umgebung, wenn sie zu hell beleuchtet ist (Kameraobjektiv, Zimmerdecke).
Viele Grüße zurück!
Mein Gott, ist diese Anleitung ausführlich und sehr gut aufbereitet und geschrieben. Hier schreibt jemand, der weiß, wovon er redet. Und das auch noch sehr verständlich und nachvollziehbar. Fantastische Arbeit!
Danke, das freut mich! Dies ist auch der längste Artikel bisher auf dieser Seite. Das Thema ist schnell zu erklären – oder ausführlich: Der Teufel steckt im Detail.
Hallo Thomas, da hast du ja einen sehr, sehr umfassenden Leitfaden für das Digitalisieren von analogen Filmen geschrieben! Es war interessant alles einmal lesen zu können, was dafür nötig ist oder vielmehr sein kann denn viele Wege führen nach Rom. Ich denke, ich werde es mit der Kaiser Leuchtplatte versuchen und besorge mir dann Antireflexglas und Klarglas (aus guten Bilderrahmen). Später vielleicht eine vernünftige Buchbildbühne. Aber erst einmal testen. Stativ und Makroobjektiv habe ich schon. Danke auch für die Vorstellung der Software. So etwas findet sich im Netz nahezu gar nicht zu diesem Thema. Ich werde mir RawTherapee einmal laden.
Hallo Thomas,
auch wenn ich vielleicht ein wenig lästig erscheine. Du schreibst:
„Ein anderer Fotofreund schreibt auf seiner ausführlichen Seite:
Vergrößerungsobjektive, mit ihrem idealen Maßstab von 1:10 bis 1:40, können sich an die gewünschte Qualität lediglich annähern.“
Als ich das las wunderte ich mich ein wenig und lud mir ein Datenblatt von Rodenstock aus dem Netz (Datenblatt). Ich denke, die Aussage des Fotofreunds ist eher im Bereich des Unsinns anzusiedeln. Tipp: nicht alles ungeprüft übernehmen was man im Netz auf Seiten von Laien findet.
Rodenstock gibt z.B für ein Rodagon 2,8/50 mm als empfohlener Maßstabsbereich 2-15x an. Für ein Apo-Rodagon-N ebenfalls 2-15x. Die anderen Brennweiten sind im Datenblatt aufgelistet. Die genannten Maßstäbe von „Deinem“ Fotofreund wären auch wenig praxisgerecht.
Ob man mit den Vergrößerungsobjektiven bessere oder schlechtere Ergebnisse erreichen kann als mit anderen Objektiven weiß ich nicht. Ich habe es nicht getestet. Mir reichte die Auflösung bei Blende 8 meines Makroobjektivs immer.
Rodenstock schreibt: „…Es erfüllt die hohen Anforderungen professioneller Reprografie und wird daher gern in den Brennweiten bis 135 mm in Kombination mit dem FokussierSchneckengang Modular-Focus und entsprechenden Kameraadaptern als hochauflösendes Aufnahmeobjektiv für CCDKameras und als exzellentes Makroobjektiv für Spiegelreflexkameras eingesetzt. Üblichen Makroobjektiven ist es im Auflösungsvermögen und Kontrast meistens klar überlegen.“
(Vergleichbare Objektive anderer Hersteller dürften nicht schlechter sein)
Eine optische Steigerung wird wahrscheinlich nur noch mit einem Apo-Rodagon-D möglich sein. Diese Objektive sind gem. Datenblatt und Aussage von Rodenstock für höchste Abbildungsqualität im Nahbereich konzipiert, da nahe Maßstab 1:1 auch beste „normale“ Vergrößerungsobjektive Schwächen zeigen sollen.*
Viele Grüße
Frau Müller
* das ist auch der Grund wieso ich z.B. Kleinbildnegative nur mit der APS-C Kamera reprodziere.
Hallo Frau Müller, die Aussage hatte ich tatsächlich so auch gedanklich übernommen. Es gilt also wie bei so vielem, hier selbst zu testen bzw. Rückschlüsse zu ziehen.
Hallo Thomas,
Danke für diese Website mit vielen nützlichen Tipps rund um die analoge Fotografie und Digitalisierung.
Der folgende Absatz muss nicht unbedingt online erscheinen, da nicht direkt zum Thema:
Auch bei mir ist analoge Fotografie (wieder) ein Thema nach 12 Jahren fast ausschließlich elektronischer Aufnahmetechnik. Ich habe noch alte 35mm Kompaktkameras, SLR mit mehreren Festbrennweiten und Nachführbelichtung und nun sogar eine Nikon F100 zur Verfügung, mit der selbst moderne Objektive mit Bildstabilisator funktionieren. Allerdings neige ich dazu, mit dieser Kamera wie mit einer Digitalen zu fotografieren. Die ältere Technik erfordert bei den Aufnahmen oft anderes Vorgehen, was für die Bildergebnisse durchaus förderlich sein kann.
Bei der Ausarbeitung der Aufnahmen, besonders in Schwarzweiss, arbeite ich jedoch gern am Computer.
Auch das (erneute) Ausarbeiten einiger Aufnahmen aus meiner Jugendzeit macht Freude, und ich musste mir eingestehen, in Sachen Aufnahmetechnik in den letzten 40 Jahren nicht viel gelernt zu haben.
So, nun zum Thema dieses Blog-Artikels:
Mein eigener Aufbau zum Negative digitalisieren ähnelt sehr deinem, mit Dreibeinstativ, Nikon D7200 und Kaiser Leuchtpult, allerdings bisher noch ein älteres mit Leuchtstoffröhren. Als Objektive habe ich ein Micro Nikkor 55mm f/2,8 und ein ebensolches AF 105mm. Das hat bei dem benötigten Abbildungsmaßstab aber wohl auch kaum über 70mm Brennweite. Richtig scharf werden beide bei Blendenzahl 8. Ich fokussiere beide manuell.
Speziell zum Thema Negativscans habe ich noch einen Kommentar:
Wie auch anderswo empfohlen, verwende ich zur Vorkompensation der orangen Farbmaske beim Farbnegativfilm einen Korrekturfilter Blau vor dem Objektiv, wie sie früher für Tageslichtfilm bei Glühbirnenlicht verwendet wurden. Damit liegen die Histogramme der Farbkanäle von Anfang an näher zusammen und ich gewinne im Grün- und Blaukanal merklich Signalqualität.
Im deutschen Sprachraum sind die Filterbezeichnungen KB12 und KB15.
Hallo Martin, vielen Dank für den Hinweis mit dem Blaufilter! Dies hatte ich auch einmal gelesen, es aber noch nicht umgesetzt. Jetzt habe ich wieder eine neue Aufgabe vor mir: Mich reizt immer, so etwas auszuprobieren bzw. zu vergleichen. Deine Argumentation hierfür erscheint hier auch durchaus schlüssig.
Gratulation zu dem sehr guten und auch sehr ausfuehrlichen Artikel.
Zum Thema Repostativ haette ich noch eien Vorschlag. Ich verwende diesen hier:
https://www.dold-mechatronik.de/Reprostativ-V5-Bausatz
Er ist sehr simpel im Aufbau, robust genug und unschlagbar guenstig.
Vielleicht ein Vorschlag fuer alle denen der Aufbau mit einem normalen Stativ zu muehsam ist und ueber Alternativen nachdenken.
lg rene
Hallo Rene, danke für den Kommentar! Den Bausatz habe ich schon verlinkt. Der sieht bereits auf dem Bild brauchbar aus. Einziger Nachteil gegenüber einem teuren Reproständer: Man hat eben keine Kurbel, mit der man die Kamera fein justieren kann. Aber vermutlich ist das auch nicht so wichtig, denn bei einem hierzu brauchbaren Stativ hat man diese ja auch nicht.
Viele Grüße zurück!
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Hinweis auf die Seite.
Sie ist toll geworden. Da steckt viel Arbeit drin.
Auf das von mir geliebte Tethering bei Repros gehst Du leider nur kurz ein. Ich benutze es inzwischen wann immer es geht; und ich mache sehr viele Repros. Das ist nicht nur für die Fotografie von Gemälden/Grafiken mit dem Digitalrückteil nützlich. Beim Abfotografieren von Negativen schätze ich es noch mehr.
Zum einen schone ich damit meinen Rücken, zum anderen kann ich bequem alles am Rechner einstellen (Belichtung und Fokus) ohne die Kamera berühren zu müssen. Weiter sehe ich sofort das Ergebnis in ordentlicher Größe.
Zum Diaduplikator fällt mir noch etwas ein. Zu teuren/besseren Balgengeräten gab es Aufsätze zum Duplizieren von Dias/Negativen. Diese sollen zum Teil sehr hochwertig gefertigt worden sein. Vielleicht ist das eine Lösung wenn man das genaue Einrichten scheut. Die exakte Parallelität sollte quasi eingebaut sein. Da ich kein Balgengerät besitze kann ich das aber nur als Idee weitergeben.
Hallo Frau Müller, vielen Dank. Zum Thema Kamera und Computer verbinden bzw. über letzteren steuern habe ich bisher nur rudimentäre Eigenerfahrungen gesammelt. Da muss ich noch etwas mehr selbst experimentieren und erweitere den Artikel sicherlich noch etwas. Hier muss ich auch mehrere Programme ausprobieren.